
Es sei „ein Schuss ins Herz der Demokratie gewesen“, sagt Guttenberg über das Attentat auf den Trump-Unterstützer Charlie Kirk, der vergangene Woche auf einer Veranstaltung in Utah auf offener Bühne erschossen wurde. Er findet anerkennende, ja geradezu lobende Worte für den 31-Jährigen, der Millionen in den USA mit seiner offenen Art begeisterte. Doch wie Guttenberg ihn einordnet, zeigt auf erschreckende Weise, wie weit sich manche Vertreter der politischen Lager bereits voneinander entfernt haben. Denn Guttenberg bezeichnet es allen Ernstes als „ungewöhnlich“, dass sich Kirk einer „interessanten Methode bedient“ habe.
Was er meint: Kirk hat einfach nur mit Menschen diskutiert, er hat sie zum Gespräch aufgefordert, Ihnen Redezeit am Mikrofon gegeben, um sich ungestört zu äußern und mit ihm zu debattieren. Kirks Motto lautete: „Proof me Wrong“ – Beweise mir das Gegenteil. „Er hat sich im Gegensatz zu vielen anderen der Diskussion gestellt“, sagt Guttenberg anerkennend, doch bereits seine Schlussfolgerung lässt schon wieder Böses ahnen. Denn in den Augen des ehemaligen Verteidigungsministers sei Donald Trump mit seiner Rhetorik selbst „verantwortlich für das, was wir dort gewahren“. Es sei ja nicht der erste Gewaltakt, der sich dort in den letzten Monaten ereignet hat. Kaum denkt man, Guttenberg habe die Kurve gekriegt, ist er schon wieder herausgeflogen.
Sogar Gregor Gysi, der mit Guttenberg einen gemeinsamen Podcast unterhält, stimmt mit ein. Der SED-Linke verurteilt explizit, was seine Partei-Kollegin Heidi Reichinnek jüngst bei Caren Miosga über das Attentat von sich gab. Sie hatte Unverständnis darüber geäußert, dass der Mord betrauert wird. Gysi: „Verurteilen muss ich es. Mord ist niemals die Lösung eines Problems, sondern schafft immer nur neue Probleme und neuen Hass.“ Doch auch er schlittert flugs wieder aus der Kurve. „Wenn Sie die Töne bei uns hören …“, setzt er an, um dann sofort auf die entglittenen Sitten im Bundestag und Trump zu kommen. „Wir stehen durch Trump unter Druck, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abzubauen, wir stehen durch die AfD unter Druck.“ Und „die dazwischen, die Rechtstaat, Freiheit und Demokratie verteidigen wollen“, die seien „nicht in der Lage, sich zu organisieren“.
Gysi: „Was Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit wirklich bedeuten, wissen wir erst, wenn wir es los sind. Dann begreifen wir es. Aber dann ist es zu spät.“ Klingt wie die Bewerbungsformel für einen AfD-Aufnahmeantrag, kommt aber vom Vertreter der ehemaligen Mauerschützenpartei. Lustiger wird es an diesem Abend nicht mehr.
Bei all dem ausgedehnten Demokratie-Flötenspiel beschleicht den Zuschauer ein ungutes Gefühl. Einerseits ist es schön zu beobachten, wie zwei politisch so gegensätzliche Menschen wie Guttenberg und Gysi derart entspannt miteinander parlieren. Dass sie sogar einen gemeinsamen Podcast bespielen, könnte ein Indiz dafür sein, dass Diskurs noch funktioniert. Doch gerade der überjoviale, brüderschaftliche Auftritt der beiden bei Maischberger lässt genau das Gegenteil befürchten. Diese übertriebene Entspanntheit, das demonstrative Suhlen im „Agree to Disagree“, das gegenseitige Ans-Knie-Fassen – all das wirkt verdächtig und besorgniserregend. Dem Zuschauer schwant: Leuten wie Gysi und Guttenberg ist – egal um welches Thema es geht – am Ende doch alles egal. Man suhlt sich in Losungen, in plakativen Parolen und möglichst gut zitierfähigen Phrasen, doch tatsächlich geht es beiden gar nicht um irgendeine Haltung, eine Sache oder gar eine Problemlösung. Es geht um das Debattieren selbst und eine möglichst perfekte Selbstdarstellung. Dass die beiden dabei nicht wirklich streiten, sondern sich gegenseitig die Knie kneten, entlarvt das Schauspiel als Trauerspiel.
Denn was eigentlich die unmenschlichen Reaktionen aus deutschen Kehlen waren, benennt keiner der Anwesenden. X-Posts von Ruprecht Polenz oder „El Hotzo“ (Sebastian Hotz), Fernsehbeiträge von Elmar Theveßen oder Dunja Hayali – alles Äußerungen, die so falsch, erfunden, niederträchtig und verachtenswert sind, dass wir sie hier gar nicht wiederholen wollen, kommen in der Sendung nicht aufs Tableau. Alles verschwimmt in einer grauen, undefinierten Masse, die man schnell und leicht wieder zu einer Generalkritik an Trump und den Rechten umdeuten kann.
Allein die ARD-Korrespondentin und Juristin Iris Sayram bringt etwas Nüchernheit in die Betrachtungen. Sie bezweifelt, ob es wirklich russische Drohnen waren, die da kürzlich in Polen auf irgendwelchen Hühnerställen ihr zartes Styroporkleid zerfledderten. sie erinnert an die längst vergessen-verdrängte Nordstream-Pipeline, die am Ende wohl doch eher von der Ukraine und nicht von Russland gesprengt wurde. Sie erwähnt, dass die angebliche GPS-Signalstörung des von-der-Leyen-Flugzeugs wohl doch eher eine Phantasiegeschichte war – all das genug, um sich in der illustren, ach so herrlich einstimmigen Runde fast ins Abseits zu manövrieren.
Zum Glück darf Sayram das alles nicht weiter ausführen, wo kämen wir denn da hin.
Und was fehlt, damit die Talkshow-Chose richtig rund wird? Korrekt: Kriegsangst, Aufrüstung und Wehrpflicht. Guttenberg warnt, man dürfe „nicht so tun, als sei es eine neue Bedrohungslage“, denn „faktisch haben wir die seit Jahren“. Putin plane Böses, und „wir befinden uns in einem Kriegsszenario“. Der Turnschuh-Feldherr mahnt: „Wir können nicht warten, bis die Gefährdungslage noch größer geworden ist.“
Nur Gysi gibt hier Kontra. Er hält Putin für nicht gar so bescheuert wie die übrige Runde: „Ich glaube, er will nicht ernsthaft die Nato angreifen“, sagt der SED-Altvordere, denn „das würde den dritten Weltkrieg auslösen“. Seit Jahren würden uns Waffen-Apologeten wie Marie-Agnes „Flak“ Strack-Zimmermann oder Roderich „Kriegsgewitter“ Kiesewetter erzählen, dass die Ukraine unbedingt siegen muss. Doch das, sagt Gysi, sei „sowas von weit entfernt“.
Ungefähr so weit entfernt wie eine Stunde Maischberger vom realen Leben.
Als es etwa um innenpolitische Probleme geht, fallen zwar zahlreiche Stichworte: geschlossene Schwimmbäder etwa, kaputte Schultoiletten, mangelnde Digitalisierung, sogar irgendwelche Clubräume, Jugendzentren und, und, und. Aber die magischen Worte mit M, etwa Migrationsdruck oder Messergewalt, kommen mal wieder nicht vor. Stattdessen darf der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) seine Sicht auf die Migration äußern. Und diese Sicht steht sinnbildlich für eine Kultur, die Probleme partout nicht beim Namen nennen will. Die Frage, so sagt er, sei: „Was hat uns Migration an Positivem gebracht und was sind die Herausforderungen?“.
Herausforderungen. So kann man es sicher auch nennen.






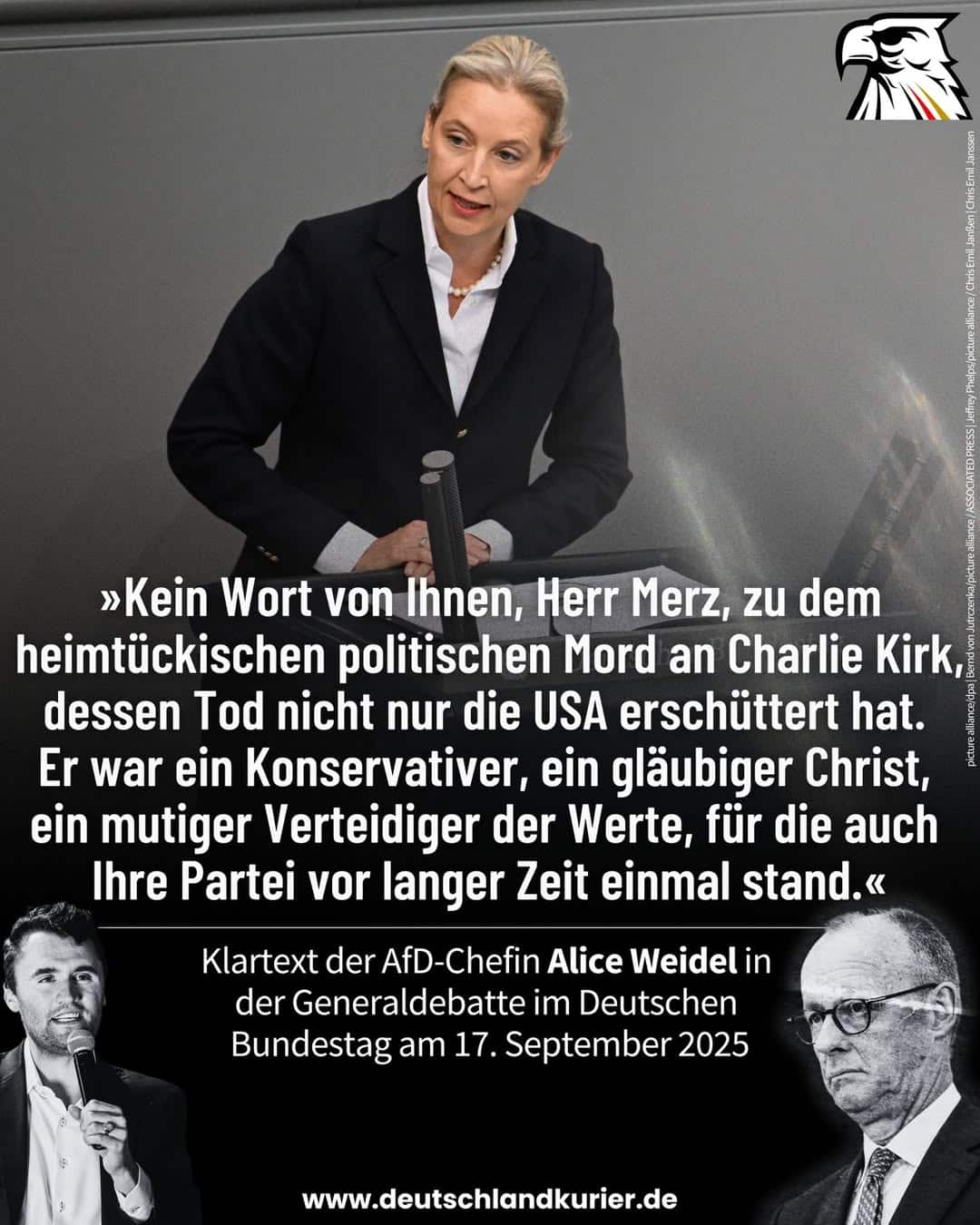


 BUNDESTAG LIVE - 24. Sitzung - AfD-Fraktion im Bundestag
BUNDESTAG LIVE - 24. Sitzung - AfD-Fraktion im Bundestag






























