
Am Abend eines laut ihr „für unsere Demokratie unheilvollen, schwarzen Tages“ saß Marine Le Pen in der meistgeschauten Nachrichtensendung des privaten Senders TF1. Anfangs mit verschränkten Armen ließ sie bald ihren Widerstandsgeist, aber auch ihren Zorn aufblitzen, blieb dabei aber höflich und verteidigte sich durchaus eloquent vor dem französischen Publikum. Der Moderator wirkte geradezu eingeschüchtert – auch das ist ein Zeichen, wie ambivalent man in Frankreich dieses Urteil sieht.
Le Pen wurde nicht allein zu einem Amtsverzicht für fünf Jahre verurteilt, sondern auch zu vier Jahren Freiheitsstrafe, von denen sie zwei mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause absitzen soll, der Rest würde auf Bewährung ausgesetzt. Hinzu kommt eine Geldstrafe von 100.000 Euro. Man kann das als Demütigung ansehen, doch Frankreich tut das gelegentlich seinen Politikern an, etwa dem konservativen Ex-Premier François Fillon oder seinem Förderer Nicolas Sarcozy, während François Bayrou von der macronistisch-liberalen Modem-Bewegung bisher straffrei ausging. Täuscht eigentlich der Eindruck, oder sind es vor allem rechtsstehende, konservative Politiker, die so abgestraft werden? Auch der junge Parteichef Jordan Bardella sagte: „Es besteht der Eindruck, dass es ein politisches Lager häufiger trifft als das andere.“
Dennoch sticht dieses Urteil gegen Le Pen durch eine Eigentümlichkeit heraus. Das passive Wahlrecht wurde ihr mit sofortiger „vorläufiger“ Wirkung entzogen, obwohl sie das Amt einer EU-Abgeordneten, in dem sie die Veruntreuung von Steuergeldern begangen haben soll, nicht mehr innehat. Das Mittel der „vorläufigen Vollstreckung“ ist aber an sich gerade dafür gemacht, um einen Amtsinhaber davon abzuhalten, sein verurteiltes Tun fortzusetzen. Dazu hat Le Pen auch objektiv betrachtet keine Möglichkeit. Sie kann derzeit keine Fraktionsmitarbeiter aus dem EU-Parlament in Frankreich für Parteizwecke verwenden und würde sich vermutlich hüten, das zu tun, einfach weil sie inzwischen die Chefin einer gewachsenen Fraktion in der französischen Nationalversammlung ist und gar keinen Bedarf mehr an solcher„Veruntreuung“ oder Zweckentfremdung hätte. Im übrigen weist Le Pen darauf hin, dass das EU-Parlament auch „lokale“ Mitarbeiter kennt, deren Tätigkeit in den EU-Mitgliedsländern, nicht in Brüssel liege.
Interessant ist auch ein weiteres Faktum: Der Bürgermeister von Perpignan, Louis Aliot (RN), wurde nicht mit „vorläufiger Vollstreckung“ seines Wahlrechtsentzugs belegt. Er darf Bürgermeister bleiben. Schon das deutet auf eine selektive Rechtsprechung hin, weil man den direkten Volkszorn (oder andere Folgen) in der Mittelmeerstadt fürchtet.
Natürlich wird Le Pen so schnell wie möglich gegen die Entscheidung Berufung einlegen, auch wenn sie der Meinung ist, dass diese Berufung – ein Grundrecht im westlichen Rechtsstaat – durch das Gericht teilweise ungültig gemacht wurde. Immerhin wird so die Geld- und Haftstrafe ausgesetzt.
Manche der Befragten in der Straßenumfrage des Senders TF1 sehen klar eine „Hexenjagd“ und den Versuch, eine unbequeme Politikerin „auf die eine oder andere Art zu knebeln“. Ein anderer Mann aus dem Volk sagt, man werde durchhalten und hoffen. Sogar der Fraktionschef der Republikaner Laurent Wauquiez meint: „Es ist nicht gesund, dass es in einer Demokratie einer gewählten Politikerin verboten wird, bei kommenden Wahlen zu kandidieren. Die politischen Debatten müssen an den Urnen entschieden werden.“
Auch Elon Musk kommentierte das Geschehen: „Wenn die radikale Linke eine demokratische Abstimmung nicht gewinnen kann, missbraucht sie das Rechtssystem, um ihre Gegner ins Gefängnis zu bringen. Das ist ihr Standard-Drehbuch in der ganzen Welt.“ Es ist dieser Gedanke, der auch über der medialen Diskussion in Frankreich hängt wie ein Damoklesschwert.
Auch Donald Trump äußerte sich, nannte den Ausschluss Le Pens „eine sehr große Sache“: „Sie wurde für fünf Jahre gesperrt und sie war die Favoritin.“ Aber im Grunde erinnere ihn das an sein eigenes Land, sehr sogar.
Den Gerichtssaal hatte Le Pen vorzeitig verlassen, bevor noch die vorsitzende Richterin ihre „Erklärungen“ zum Fall beendet hatte. Alles an ihr drückt ihre Ablehnung aus. Wenige Minuten später ist sie im Hauptquartier ihrer Partei angekommen, wo zweifellos sofort die Bewertung des Geschehens begann. Im Interview mit TF1 sagt sie, dass die vorsitzende Richterin selbst erklärt habe, dass sie ein politisches Urteil fällen würde. Das Ziel hinter der „vorläufigen Vollstreckung“ der Unwählbarkeit sei – in den Worten der Richterin! – gewesen, die Kandidatur Le Pens bei den kommenden Präsidentschaftswahlen zu verhindern. Damit habe die Richterin zudem gegen den Rechtsstaat verstoßen, so Le Pen. Denn wenn man in Frankreich Berufung einlege, hebe diese Berufung das Urteil der ersten Instanz auf, stelle die Unschuldsvermutung für den Angeklagten wieder her. Ein zweites Urteil wird notwendig, um den Fall abzuschließen.
Der Moderator fragt, auch das interessant, ob die Richterin mit ihrem Urteil einer Vorgabe von außen, einer Anweisung oder einem „Klima“ gefolgt sei. Oder hat sie den „politischen Tod Le Pen“ in „Eigenregie“ beschlossen? Le Pen erwidert, dass gewisse Richter keine Anweisung brauchen. Die Rechtsstaatlichkeit sei durch diese Entscheidung verletzt worden.
Die juristischen Feinheiten können in Deutschland nicht interessieren, aber Le Pen trug außerdem vor, dass die Richterin Bénédicte de Perthuis in verfehlter Weise den „Geist eines Gesetzes“ angewandt habe, das für den Fall keine Gültigkeit haben kann, weil es noch nicht beschlossen war. Gemeint ist das Gesetz Sapin 2, in dem die „vorläufige Vollstreckung“ in gewissen Fällen automatisch wird. Auch die Richterin habe das zugegeben. Es gehe mithin um „Praktiken, von denen man glaubte, sie seien autoritären Regimen vorbehalten“. Millionen von Franzosen seien durch einen erstinstanzlichen Richter derjenigen Kandidatin beraubt worden, die heute als Favoritin im Wettrennen um das Präsidentenamt gilt.
Und das bleibt wohl ihr stärkster, zornerfülltester Satz: „Stellen Sie sich vor, ich würde nach einer Präsidentschaftswahl, bei der ich nicht hätte antreten können, durch ein Urteil des Berufungsgerichts entlastet. Was wäre die Legitimität desjenigen, der in dieser Wahl gewählt worden wäre?“
Nach einem Nachfolger oder Ersatz befragt, wenn sie 2027 wirklich nicht antreten könnte, lobt Le Pen vor allem Bardella, von dem sie aber hoffe, ihn nicht allzu bald einsetzen zu müssen. Bardella hat ihr am Dienstag früh im Nachrichtensender CNews zugestimmt und von einer „Tyrannei der Richter“ gesprochen.
Am Montagabend gibt sich Le Pen kämpferisch, will sich nicht „eliminieren lassen“. Man dürfe sich an solche Dinge nicht gewöhnen: „Ich werde an der Seite der Franzosen sein. Seit 30 Jahren kämpfe ich für sie und gegen die Ungerechtigkeit. Und ich werde das bis zum Ende machen.“ Le Pen wird nicht aufgeben. Das versteht man. Und sie zitiert den General de Gaulle, der gesagt habe: „Das höchste Gericht ist das Volk.“ Der Moderator scheint aber diesen Satz nicht zu verstehen und erwidert: „Der Verfassungsrat.“ Nein, das Volk ist der höchste Richter, kein von Politikern besetzter Stuhlkreis.
Der Moderator schlägt sogar vor, dass Le Pen sich an den Staatspräsidenten wenden könne, um eine Begnadigung zu erreichen. Aber sie lehnt ab: Die Begnadigung folge auf ein definitives Urteil. Le Pen erhofft sich ein anderes Urteil durch ein endlich neutrales Berufungsgericht. Denn sie und ihre damaligen EU-Fraktionskollegen seien vollkommen unschuldig. Es gehe nur um eine Meinungsverschiedenheit zwischen der Parlamentsverwaltung und verschiedenen Fraktionen. Sie bemerkt fast abschließend, dass es offenbar im heutigen Frankreich nicht gut sei, zur Opposition zu gehören.
Die gleichen Vorwürfe, die heute in aller Öffentlichkeit das Rassemblement national betreffen, beträfen auch die Parteien von Premierminister Bayrou und von Jean-Luc Mélenchon (die radikal-linke „France insoumise“). Nun war Bayrou nicht unbedingt sehr oppositionell, aber dass gegen ihn noch ein Berufungsverfahren in ähnlicher Sache anhängig ist, bleibt interessant – ebenso die in diesem Fall vom Gericht vertretene Meinung, Bayrou habe nichts von dem System der Fraktions- oder Parteimitarbeiter gewusst. Le Pen wird dieses Wissen dagegen unterstellt. Und da wären wir wieder bei der Ungleichbehandlung, die verschiedenen politischen Richtungen durch die Richter zu widerfahren scheint.



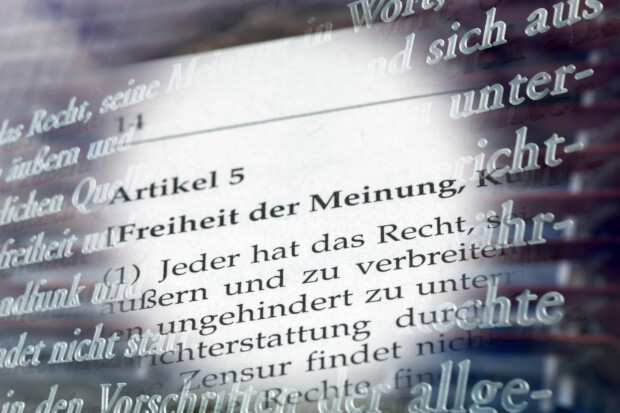





 PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM
PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM





























