
Immer häufiger landen Äußerungen vor Gericht, die als Holocaustverharmlosung gewertet werden, meist auf Grundlage von § 130 Strafgesetzbuch, dem Volksverhetzungsparagrafen. Zugleich greift die politische und mediale Rhetorik selbst immer unverhohlener zu NS-Vergleichen: „Nie wieder ist jetzt“, „1933 steht vor der Tür“, „die AfD ist die neue NSDAP“ – solche Formeln gehören heute zum Standardrepertoire auf linken Demos, in Bundestagsreden und Leitartikeln. Es entsteht ein eklatantes Missverhältnis: Während bestimmte Analogien zur NS-Zeit strafrechtlich verfolgt werden, gelten andere als moralisch geboten. Dass das eine als Volksverhetzung gilt, das andere nicht, ist nicht Ausdruck rechtsstaatlicher Klarheit, sondern linker Ungleichbehandlung.
Schon die Kritik an selektiv verwendeten Maßstäben kann in Schwierigkeiten führen: So erging es kürzlich einer Frau, die wegen „Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ einen Strafbefehl in Höhe von 3.500 Euro erhielt, weil sie Lauterbach und einen „Querdenken“-Redner gegenüberstellte, wie beide eine Geste zeigen, die oberflächlich einem Hitlergruß ähnelt (NIUS berichtete). Sie kritisiert, es werde „mit zweierlei Maß“ gemessen.
Während der Kritiker der Corona-Maßnahmen für seine Geste bestraft wurde, weil man sie ihm als verfassungswidriges Kennzeichen auslegte, käme die Justiz nicht auf die Idee, Lauterbach einen gezeigten Hitlergruß zu unterstellen. Das war offensichtlich die Botschaft. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ist indes der Auffassung, die belangte Frau habe etwas anderes sagen wollen – was genau, ist schwer zu rekonstruieren, weil es den gesunden Menschenverstand so grundsätzlich verletzt. Die Frau, so gibt Apollo News die Sicht der Staatsanwaltschaft wieder, soll „willentlich bezweckt haben, dass die Geste von Passanten [als Hitlergruß] wahrgenommen werde.“
Eine verurteilte Frau wollte Ungleichbehandlung in der Justiz zum Thema machen – und bekam eben diese selbst zu spüren.
Um zu verstehen, wie sich der politische und juristische Diskurs um Holocaustverharmlosung verselbstständigt hat und ausgeufert ist, lohnt ein Blick in die 1990er Jahre. Im Oktober 1994 wurde der § 130 Volksverhetzung um Absatz 3 ergänzt: Bestraft wird seitdem, wer „unter der Herrschaft des Nationalsozialismus“ begangene Handlungen, die nach Völkerstrafgesetzbuch unter Völkermord fallen, „billigt, leugnet oder verharmlost“, und zwar „in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.“ Zwar war es auch davor möglich, Holocaustverharmlosung mithilfe anderer Strafparagrafen zu bestrafen, doch aufgrund kontroverser Gerichtsurteile, die für Empörung gesorgt hatten, folgte der Gesetzgeber mit einer Erweiterung des Paragrafen.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte im April 1994 ein Urteil gegen NPD-Chef Günter Deckert aufgehoben, der zuvor wegen Volksverhetzung verurteilt worden war. Die bloße Leugnung des Holocaust, argumentierte der BGH, reiche für eine Verurteilung wegen Volksverhetzung (§ 130) nicht aus, sofern den Opfern nicht „das Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeiten in der staatlichen Gemeinschaft abgesprochen und sie als minderwertige Wesen behandelt“ würden. Jedoch, so betonte das Gericht: Das einfache Bestreiten der Gaskammermorde könne auch als „Beleidigung“ (§ 185) oder als „Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener“ (§ 189) bestraft werden. „Darauf wies der BGH ausdrücklich hin, da der Schutz der Ehre von Juden auch die Anerkennung ihres besonderen Verfolgungsschicksals erfasse“, berichtete die taz.
Ursprünglich ging es also um Äußerungsdelikte wie das Bestreiten von Gaskammern – um nachweisliche, historische Falschbehauptungen. Die Täter standen in strammer neonazistischer Tradition: NPD-Funktionär Deckert wurde später beispielsweise noch dafür verurteilt, Michel Friedman, der dem Präsidium des Zentralrats der Juden angehörte, aufgefordert zu haben, Deutschland zu verlassen.
taz, April 1994: Vier Monate später wurde Absatz 3 (Holocaustverharmlosung) in den Volksverhetzungsparagrafen geschrieben, wo er bis heute steht.
Inzwischen werden unter dem gleichen Absatz des Paragrafen Äußerungen bestraft, an die damals wohl keiner dachte. So verurteilte der Bundesgerichtshof kürzlich einen 65-Jährigen für einen Facebook-Post, der das Eingangstor eines Konzentrationslagers mit der Aufschrift „Impfen macht frei“ zeigt. Die karikaturhafte Darstellung orientierte sich erkennbar am historischen Lagertor des KZ Auschwitz mit dem Schriftzug „Arbeit macht frei“ und war mit dem Untertitel „Die Pointe des Coronawitzes“ versehen.
Der vorausgegangenen Deutung des Landgerichts Köln, „die untertitelte Abbildung verschleiere und bagatellisiere das historisch einzigartige Unrecht der in Konzentrationslagern vollzogenen Vernichtung von Millionen europäischen Juden und anderen vom nationalsozialistischen Regime verfolgten Gruppen in seinem wahren Gewicht“, folgte der Bundesgerichtshof, wie Legal Tribune Online berichtete. Der qualitativen Abwertung des NS-Völkermords „im Sinne einer Relativierung von dessen Unwertgehalt“ stehe nicht entgegen, dass der Verfasser des Posts in überzogener Weise die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen habe zum Ausdruck bringen wollen, so das Gericht weiter.
Das bedeutet: Auch wenn der Mann den Holocaust gar nicht verharmlosen wollte, sein Interesse einem ganz anderen Themengebiet galt, habe er mit seiner Analogie dessen „Unwertgehalt“ eben doch relativiert und kleingeredet. Zur Erinnerung: Eingeführt wurde Absatz 3 des Volksverhetzungsparagrafen, um handfeste Nazis zu bestrafen, denen es um das Kleinreden der Verbrechen ging – etwa, um jüdischen Reparationsforderungen die Legitimität abzusprechen. Die unbeabsichtigte Holocaustverharmlosung gehörte nicht dazu.
Folgt man der Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs, so ist Holocaustverharmlosung in Deutschland geradezu Staatsräson. Was Corona-kritische Demonstranten mitunter taten, das ist unter Linken der Standard auf jeder „Demo gegen Rechts“. Der umstrittene Verein „PolizeiGrün“ behauptete Ende Januar, nachdem die CDU mithilfe der AfD einen Entschließungsantrag verabschiedete („Fall der Brandmauer“), die politische Zusammenarbeit mit der rechtskonservativen Partei sei ähnlich schlimm wie der Massenmord in Auschwitz.
„PolizeiGrün“ löschte diesen Tweet nach einem Sturm der Entrüstung.
Damit aber tat „PolizeiGrün“ genau das, was der Bundesgerichtshof dem „Impfen macht frei“-Posting vorwarf: Eine solche „Abbildung verschleier[t] und bagatellisier[t] das historisch einzigartige Unrecht der in Konzentrationslagern vollzogenen Vernichtung von Millionen europäischen Juden (...) in seinem wahren Gewicht“. Sowohl „PolizeiGrün“ als auch der Corona-Protestler bedienten sich einer Auschwitz-Analogie, um auf einem anderen Themengebiet etwas zu kritisieren: den Fall der Brandmauer im einen Fall, im anderen die Corona-Politik. Auch der grünen Variante der Holocaustverharmlosung, so könnte man im Wortlaut besagten Gerichtsurteils argumentieren, steht nicht entgegen, dass sie in überzogener Weise die Auswirkungen der Abstimmungspolitik im Bundestag hätte ausdrücken wollen.
Dieser Holocaust-Vergleich wurde bestraft.
Weil sie so alltäglich sind, mögen sie manch einem kaum mehr auffallen: Vergleiche mit dem Nationalsozialismus sind das Kernargument einer politischen Haltung, die wie ein gemeinsames Band Bundeskanzleramt, NGO-Komplex und autonome Zentren miteinander verbindet. Dieser hanebüchenen Ideologie zufolge würde die politische Konkurrenz, die sich rechts einer sogenannten „demokratischen Mitte“ – etwa mit migrationskritischen, EU-kritischen oder anti-woken Standpunkten – positioniert, in einer Traditionslinie mit dem Nationalsozialismus stehen.
Trump, Orbán, Höcke: Der geschichtsvergessene Spiegel wähnt sich von heimlichen Hitlers umzingelt.
Was als notwendiger Schutz vor Holocaustleugnung begann, ist zu einem politischen Instrument geworden, das immer häufiger gegen Regierungskritiker zum Einsatz kommt – während staatlich alimentierte Akteure, Parteien und NGOs ungestraft NS-Vergleiche ziehen dürfen. § 130 Abs. 3 StGB, einst geschaffen, um Neonazis zu verfolgen, wird heute auch auf Personen angewandt, die nicht leugnen oder verherrlichen, sondern polemisch über Gegenwartsthemen sprechen. Entscheidend scheint dabei nicht mehr der Inhalt, sondern die Stoßrichtung der Kritik.
Das Strafrecht kennt jedoch keine Gesinnungsprüfung – zumindest sollte es das nicht. Wenn aber Auschwitz-Analogien je nach politischem Kontext als legitime Mahnung oder als Volksverhetzung gewertet werden, verliert der Rechtsstaat seine Glaubwürdigkeit. Der Fall der Frau, die mit einer Bildmontage doppelte Standards kritisieren wollte und dafür selbst kriminalisiert wurde, ist kein Ausrutscher, sondern ein Symptom. Es zeigt, wie weit sich Recht und politische Opportunität inzwischen verschränkt haben – zulasten der Meinungsfreiheit, des historischen Ernstes und der rechtsstaatlichen Gleichbehandlung.
Lesen Sie auch:Dieser Wahlkampf war die größte Holocaust-Relativierung der Geschichte








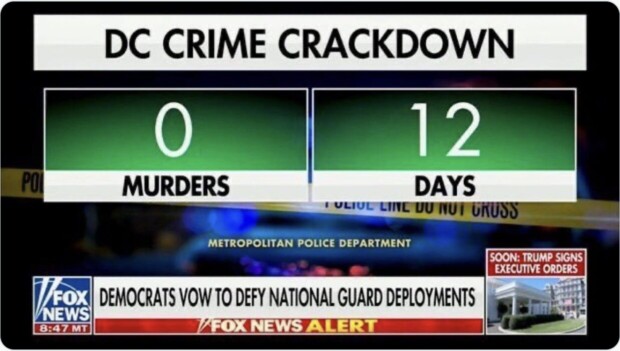

 DEUTSCHLAND RÜSTET SICH: Wehrpflicht light kommt! Junge Leute stehen vor neuen Zeitalter | STREAM
DEUTSCHLAND RÜSTET SICH: Wehrpflicht light kommt! Junge Leute stehen vor neuen Zeitalter | STREAM






























