
Die von der Bundesregierung angestrebte Energie- und Wärmewende wird nach Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey erheblich teurer als bislang veranschlagt. „Wir schätzen den bundesweiten Investitionsbedarf für die geplanten Sanierungen, Wärmenetze und Wärmepumpen bis 2030 auf 245 bis 430 Milliarden Euro“, heißt es in einer noch unveröffentlichten Analyse, über die die WELT am Sonntag zuerst berichtet hat. Zum Vergleich: Die Bundesregierung hat bis 2029 rund 270 Milliarden Euro im Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität für solche Vorhaben eingeplant.
Besonders ins Gewicht fallen demnach die Sanierungskosten im Gebäudesektor. McKinsey errechnete allein dafür 170 bis 270 Milliarden Euro. „Zusammen mit den ohnehin notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen würde sich der Betrag auf 350 bis 450 Milliarden Euro summieren“, erklärten die Autoren. Problematisch sei vor allem, dass sich Gebäudesanierungen für private Eigentümer kaum rechneten. Da Vermieter höchstens acht Prozent der Kosten auf die Miete umlegen dürfen, würden Sanierungen „bis auf Weiteres wirtschaftlich unattraktiv“ bleiben – vor allem bei einer durchschnittlichen Mietdauer von neun Jahren.
Auch die kommunalen Wärmepläne basieren laut McKinsey auf weitgehend realitätsfernen Annahmen. Während die durchschnittliche Sanierungsrate bundesweit nur 0,6 Prozent beträgt, geht Stuttgart in seinen Planungen von 3,7 Prozent aus, während Karlsruhe sogar mit 4,8 Prozent rechnet. Zugleich zeigen praktische Erfahrungen eine deutliche Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit: So sollten in Stuttgart ab 2024 jährlich eigentlich 3.400 Wärmepumpen installiert werden – tatsächlich gingen bei der Stadt jedoch nur 319 Förderanträge ein.
Für die Bürger bedeutet die Wärmewende laut McKinsey eine erhebliche finanzielle Belastung. Eine energetische Sanierung koste pro Person mit durchschnittlicher Wohnfläche in Baden-Württemberg zwischen 15.000 und 25.000 Euro – bei einer Kaufkraft von rund 30.000 Euro pro Jahr sei das für viele kaum zu stemmen.
Auch aus der Politik kommt Kritik. Lars Rohwer, Obmann der CDU/CSU im Bundestagsausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen, erklärte gegenüber WELT: „Die Debatte um das Habecksche Heizungsgesetz hat Verunsicherung in der Bevölkerung geschürt und Investitionen in Sanierungen abgewürgt, obwohl diese zur Erfüllung der Klimaziele essenziell sind.“ Geplant sei daher eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes, um Planungssicherheit zu schaffen, etwa durch steuerliche Entlastungen.
Noch deutlicher äußerte sich die baupolitische Sprecherin der AfD, Carolin Bachmann: „Die Wärmewende ist weder technisch noch finanziell machbar. Die Klimaideologie trifft auf eine kommunale Realität, die von Fachkräftemangel, ausufernder Bürokratie und einem massiven Investitionsstau von 216 Milliarden Euro geprägt ist“.




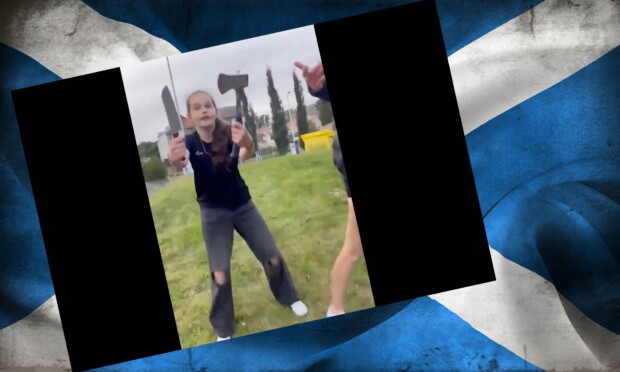

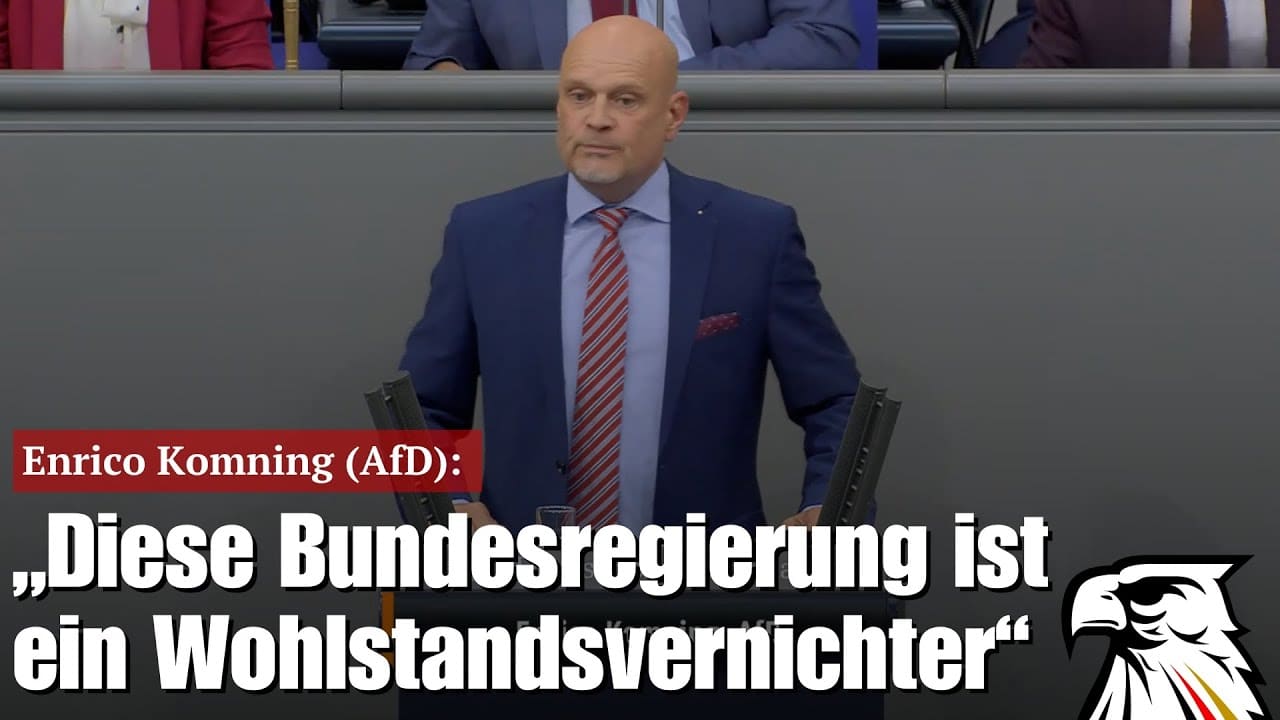


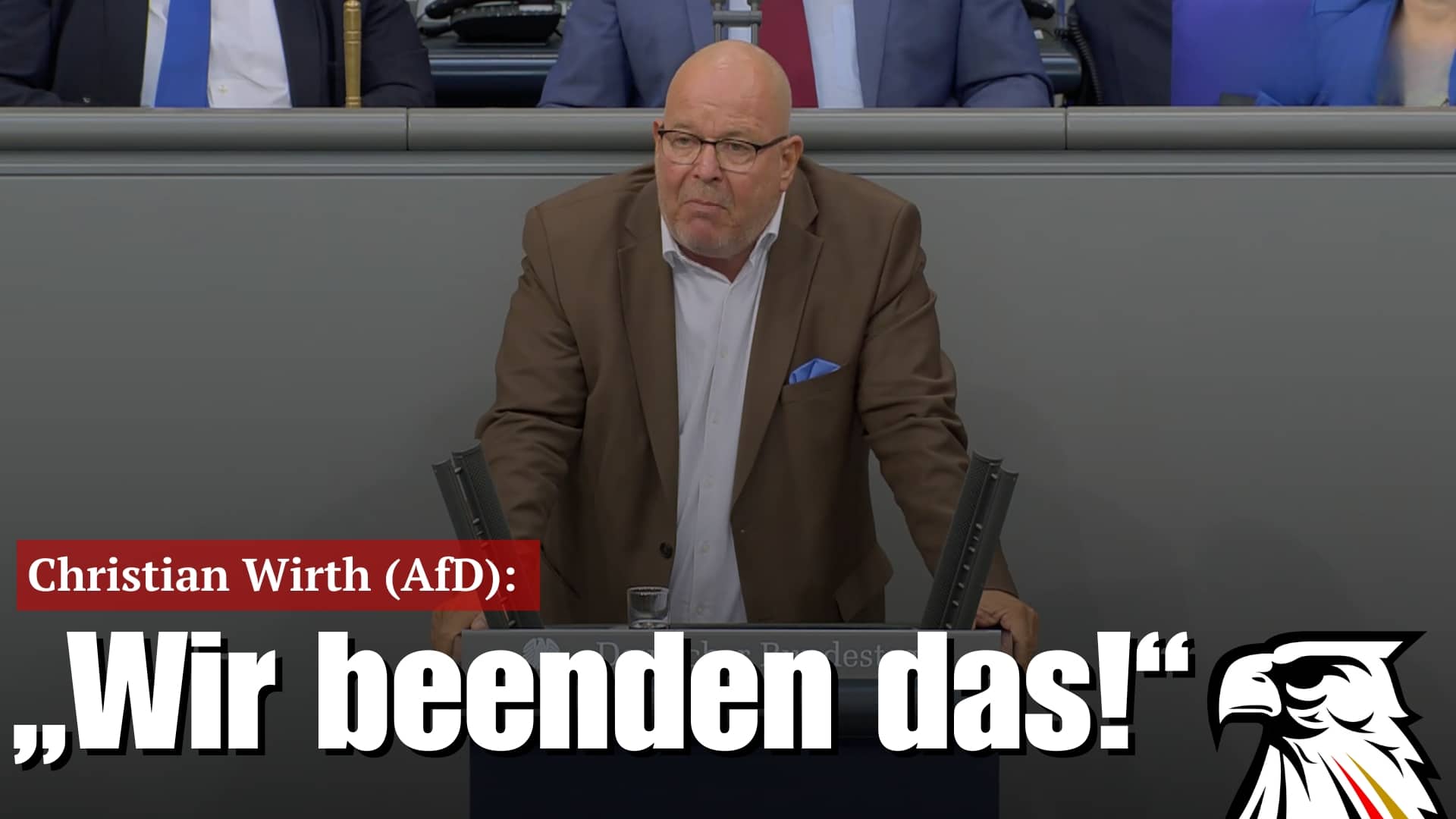
 Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025
Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025






























