
In der Hauptstadt kochen die Emotionen hoch, weil auch ein Teil des Berliner Grunewaldes für den Windrad-Irrsinn weichen soll. Nach einem Vierteljahrhundert Energiewende-Irrsinn verschandeln bereits mehr als 30.000 Windrad-Monster deutsche Küsten- und Kulturlandschaften. Mehr als 60.000 sollen es in den nächsten Jahren werden. Mal ganz abgesehen von der nicht gelösten Entsorgungsfrage hochgiftiger Rückstände drohen den deutschen Steuerzahlern durch den Rückbau von in die Jahre gekommenen Alt-Anlagen gigantische Milliardenkosten. Experten rechnen mit bis zu 500.000 Euro je Einheit – teilweise sogar deutlich mehr.
„Auferstanden aus Ruinen“ hieß es einst in der DDR-Hymne. „Zerfallen zu Ruinen“ müsste man heute dichten – eingedenk einer zerstörerischen sogenannten Klima-Politik seit der unseligen Merkel-Ära, die ungebrochen anhält. Der Verlust von mehr als 100.000 Industriearbeitsplätzen allein im vergangenen Jahr und eine Rekordzahl von Insolvenzen sorgen für Industrie-Brachen, welche die wenigen Neuinvestitionen deutlich überwiegen.
Auch die sogenannten „Neuen Energien“, die dem Volk einst als Motor eines „grünen Wirtschaftswunders“ angepreist wurden, bringen inzwischen zahlreiche Ruinen hervor. Wie von vielen Experten vorhergesagt, bleibt ein großer Teil der stillgelegten Windkraftanlagen (WKA) einfach stehen und wird nicht rückgebaut. Weil für den Rückbau vielfach das Geld fehlt oder die Betreiber pleite sind.
Nach einem Bericht der „Lausitzer Rundschau“ wurden Stand Mai 2025 in Brandenburg, dem Bundesland mit den nach Niedersachsen meisten Windrädern, in den zurückliegenden fünf Jahren 195 WKA stillgelegt, aber nur 86 zurückgebaut.
In der Uckermark, der Heimat von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die den Windrad-Irrsinn einst begann, ist die Lage besonders augenfällig. Im selben Zeitraum wurden hier 76 Anlagen vom Netz genommen und nur 21 demontiert.
Zuständigkeits-Chaos und Gesetzes-Wirrwarr
Die Rückbauverpflichtung für WKA gilt erst seit 2004 und ist länderspezifisch verschieden geregelt. Generell gilt das Baugesetzbuch des Bundes (BauGB), das den vollständigen Rückbau vorsieht und die Herstellung des vorherigen Zustandes. Dazu gehört auch die vollständige Entfernung des Fundaments, die Entsiegelung der Fundamentfläche sowie der Schwerlaststraßen und Montageplätze.
Weiterhin gelten das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) für Anlagen mit mehr als 50 Metern Nabenhöhe, das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), das Chemikaliengesetz (ChemG) bezüglich des Schwefelgases SF6 in den Schaltanlagen, das nach Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV) vom Hersteller dieser zurückzunehmen ist. Für Elektro- und Elektronikgeräte in WKA gilt wiederum das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG).
Weiterhin gelten die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), die Baustellenverordnung (BaustellV), die Altölverordnung (AltölV) und mit der Mantelverordnung (Ersatzbaustoffverordnung) ein Paket mehrerer aufeinander abgestimmter Verordnungen, die Regelungen zum Beispiel über den Bauschutt beinhalten. Hinzu kommen länderspezifische Regelungen.
Wer aber überwacht eigentlich den Rückbau der verottenden Anlagen? Gute Frage!
Eine TÜV-Überwachung gibt es nicht, obwohl die WKA-Monster eine beachtliche Höhe haben, teilweise deutlich höher als der Kölner Dom (157 Meter). Ebenso gibt es keine behördliche oder brancheninterne Unfall- oder Havarie-Datenbank. Verantwortlich sind die Landesumweltämter, denen die Sache aber offenbar über den Kopf wächst. Zudem sind die Zuständigkeiten zwischen Landesumweltämtern, Bauämtern, gegebenenfalls auch Forstämtern unklar verteilt.
Auch zu den durchschnittlichen Kosten des Rückbaus oder von Teilleistungen gibt es kaum genaue Angaben. Die Summen variieren laut Experten zwischen 30.000 Euro bei kleineren Anlagen und 515.000 Euro und mehr bei größeren.
Wer zahlt, wenn keiner zahlt?
Die Länder sichern sich bezüglich der Rückbaukosten ab. Das soll verhindern, dass die Kosten der öffentlichen Hand zur Last fallen, wenn die Eigentümer, aus welchem Grund auch immer, nach der Betriebszeit der Anlagen zahlungsunfähig sind.
Die Anlagen sind in der Regel von den Herstellern für eine Betriebszeit von 20 Jahren ausgelegt, weil dann nach Auslaufen der EEG-Förderung sich ein wirtschaftlicher Betrieb kaum noch rechnet. Zum Vergleich: Kohlekraftwerke kommen locker auf 50 Jahre Laufzeit, Kernkraftwerke auf bis zu 80 Jahre.
Selbst wenn es möglich wäre, Atomstrom durch Windstrom zu ersetzen, bräuchte man, Stand heute, vier Generationen an WKA, um ein einziges Kernkraftwerk zu ersetzen. Diese Materialschlacht ist theoretisch wie auch praktisch nicht umsetzbar, wie der Hamburger Ex-Umweltsenator und frühere RWE-Manager, Fritz Vahrenholt (SPD), vor kurzem erläuterte.
Die Rückbaukosten der Zukunft sind alles andere als überschaubar. Die fachgerechte Entsorgung der Rotorblätter wird aufgrund der anfallenden großen Menge auf jeden Fall teuer werden. Bis 2030 fallen nach Branchenangaben etwa 20.000 Tonnen pro Jahr an, in den 30er Jahren sogar 50.000 Tonnen. Die Fundamente müssen nicht nur entfernt, die Löcher müssen auch mit Boden verfüllt werden inklusive eines naturnahen Bodenaufbaus.
Der Energieaufwand für den Rückbau ist erheblich, die steigende CO2-Bepreisung für Diesel (Fahrzeuge bzw. schweres Gerät) wird die Preise treiben.
Ein gesetzeskonformer Rückbau bedeutet zudem eine sinnvolle Nutzung des anfallenden Materials im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Diese ist auch energieintensiv und wird perspektivisch teurer werden. Obendrein wird bei vielen Bauteilen einer WKA eher ein Downcycling zu Billigmaterialien anstelle eines hochwertigen Recycling stattfinden.
Absehbar ist, dass angesichts der Inflation über 20 Jahre hinweg die hinterlegten Sicherheitsleistungen kaum reichen werden. Kann der Eigentümer dann nicht nachschießen, etwa wegen Insolvenz oder Unauffindbarkeit, landet das Problem beim Landbesitzer. Hat auch der über die Pachteinnahmen keine Rücklagen gebildet und erklärt die Insolvenz, müssen es am Ende die Steuerzahler richten! Sie zahlen dann trotz jahrzehntelanger EEG-Kosten die „Beerdigungskosten“ einer für die sichere Stromversorgung untauglichen Energietechnologie.
Wie teuer der Windrad-Irrsinn die Deutschen am Ende wirklich zu stehen kommt – die Antwort gibt ein 60er Jahre Klassiker von Bob Dylan: „The answer, my friend, is blowin in the wind…“
Quelle




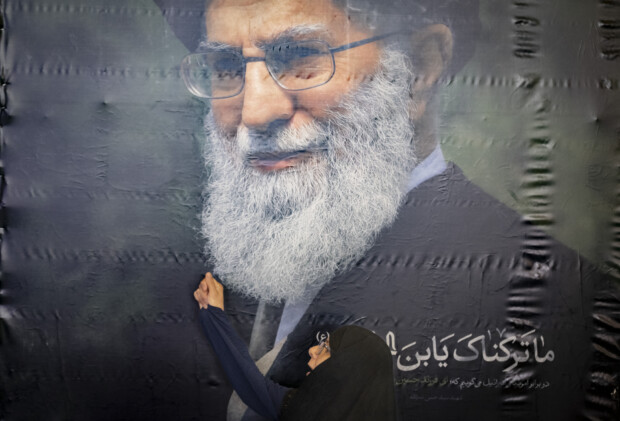




 Washingtons Megagipfel: Selenskyj mit Rückenwind aus Europa! – Entscheidende Woche für die Ukraine?
Washingtons Megagipfel: Selenskyj mit Rückenwind aus Europa! – Entscheidende Woche für die Ukraine?






























