
Die Bundesregierung hat ihren 30. Subventionsbericht vorgelegt. Aufgesetzt auf den Haushaltsplan für das Jahr 2026 steigen die direkten Finanzhilfen und Steuervergünstigungen, die der Bund der Wirtschaft gewährt, von 45 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf 77,8 Milliarden Euro. Der Sprung erklärt sich vor allem dadurch, dass der Bund im vergangenen Jahr den Finanzierungsbedarf im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) übernommen hat, um Stromverbraucher zu entlasten. Wie die Rheinische Post mit Verweis auf das Bundesfinanzministerium berichtete, betrage diese Fördersumme allein 18,5 Milliarden Euro im Jahr.
Während die auf den Bund entfallenden Steuervergünstigungen leicht rückläufig sind – von 19,7 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf 18,4 Milliarden im Jahr 2026 –, bleibt das Volumen der Finanzhilfen hoch. Fast 90 Prozent dieser Mittel dienen laut dem Bericht dem „ökologischen und digitalen Wandel“: vom Wasserstoffhochlauf über Mikroelektronik bis hin zur Dekarbonisierung von Verkehr und Gebäuden. Selbst der soziale Wohnungsbau firmiert inzwischen als Transformationsprojekt.
Der Bund lenkt damit rund zwei Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts nach Maßgabe politischer Vorgaben über einen künstlichen Markt und entzieht so dem freien Kapitalmarkt wertvolle Ressourcen. Doch ist dies nur die halbe Wahrheit. Um das tatsächliche Ausmaß staatlicher Aktivitäten zu erfassen, müssen die Zahlen, ähnlich wie bei der Arbeitslosenstatistik, zunächst im Detail betrachtet und dann um fehlende Posten ergänzt werden. So tauchen im aktuellen Bericht beispielsweise die zusätzlichen zehn Milliarden Euro jährlich nicht auf, die aus dem neu geschaffenen Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) – mit einem Gesamtvolumen von einer halben Billion Euro bis 2045 – in Subventionen fließen.
Ebenfalls außen vor bleiben mehrere Milliarden Euro, die über Fördertöpfe des Green Deal aus Brüssel nach Deutschland zurückströmen: Gelder, die zuvor vom deutschen Steuerzahler an die EU überwiesen und anschließend nach ideologisch motivierten Kriterien neu verteilt werden. Auf diese Weise errichtet der Staat eine eigene Kunstökonomie, die er Jahr für Jahr mit immer höheren Summen am Leben erhält.
Mit dem im März 2025 beschlossenen Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) hat der Bundestag ein neues Finanzvehikel aufgelegt, das nach Angaben der Regierung dazu dienen soll, die Modernisierung der Infrastruktur voranzutreiben und die Klimaneutralität bis 2045 sicherzustellen. Tatsächlich bedeutet es vor allem eines: einen weiteren gewaltigen Subventionstopf. Von den Mitteln fließen 100 Milliarden Euro direkt in den Klima- und Transformationsfonds (KTF), also in jenen Fonds, der schon heute mit jährlich zweistelligen Milliardenbeträgen industriepolitische Projekte speist.
Weitere 100 Milliarden Euro werden den Ländern zur Verfügung gestellt, die damit ihrerseits Förderprogramme auflegen und in die Wirtschaft intervenieren. Rechnet man die üblichen Ausschüttungsrhythmen solcher Sondervermögen auf die Laufzeit um, ergibt sich daraus ein zusätzliches jährliches Subventionsvolumen im zweistelligen Milliardenbereich. Hinter der Fassade von Infrastruktur und Klimaneutralität verbirgt sich damit nichts weniger als ein staatliches Dauerprogramm zur gezielten Lenkung von Kapitalströmen – mit einer Marktwirkung, die weit über die im offiziellen Subventionsbericht ausgewiesenen Summen hinausgeht.
Diese massiven Subventionen der grünen Kunstökonomie passen nicht in die Zeit, in der sich der Staat trotz klammer öffentlicher Kassen und wachsender Defizite in den Sozialversicherungen in einen regelrechten Ausgabenrausch versetzt hat. Und dies trotz, oder möglicherweise gerade aufgrund, der jährlich steigenden Steuereinnahmen. Politik und Wirtschaft haben sich längst an das süße Gift der Subventionen gewöhnt. Im Ergebnis wächst eine Abhängigkeit, die sich wie selbstverständlich immer weiter fortschreibt.
In dieses Bild fügt sich auch die Forderung von RWE-Chef Markus Krebber. Strom in Deutschland ist zu teuer – und wird es nach seiner Einschätzung auch bleiben. Doch lässt die Einführung eines Industriestrompreises weiter auf sich warten. Am fehlenden Geld könne es nicht liegen, so Krebber: Wenn der Bund jährlich Subventionen in dreistelliger Milliardenhöhe für Energiewende und Transformation aufbringen könne, dann dürften auch zehn bis fünfzehn Milliarden Euro pro Jahr für einen günstigeren Industriestrompreis kein Problem sein.
Krebber verlangt genau diese Größenordnung an zusätzlichen Hilfen, um die Energiekostenkrise zu entschärfen und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu stützen.
Die Subventionsspirale dreht sich schneller – und sie wird längst von der Wirtschaft aktiv mitbewegt.
Geht es darum, den bequemen Weg zu wählen, den Steuerzahler zusätzlich zu belasten oder über neue Schulden strukturelle Probleme zu überdecken, herrscht zwischen den politischen Kreisen und der deutschen Konzernlandschaft weitgehend Einigkeit. Auch die Automesse IAA hat gezeigt, dass die Energiekrise und die angespannte Wettbewerbssituation der deutschen Unternehmen durchaus erkannt werden. Doch das Herzstück des Problems, der Green Deal und seine interventionistisch-regulatorische Ausrichtung, bleibt unerwähnt. Es herrscht der Glaube, über Staatshilfen, Subventionen und Preisregulierung zum wirtschaftlichen Erfolg zu kommen.
Die Politik hat sich von der zentralen Bedeutung eines freien Kapitalmarktes für Wachstum und Wohlstand weit entfernt. Man könnte die Wirtschaft mit einer Pflanze vergleichen: Investitionen, die über den freien Markt gesteuert werden, wirken wie guter Dünger, der sie gedeihen lässt. Jeder Euro hingegen, der durch die Subventionsmaschine des Staates gelenkt wird, ist im Wesentlichen ein verlorener Euro. Der Niedergang der deutschen Wirtschaft ist nicht zuletzt das Ergebnis des Irrglaubens an Zentralplanung und ideologisch motivierte Steuerung des Wirtschaftsgeschehens – eine Entwicklung, die mit Blick auf den Arbeitsplatzabbau und die Insolvenzzahlen am Standort Deutschland unübersehbar ist.


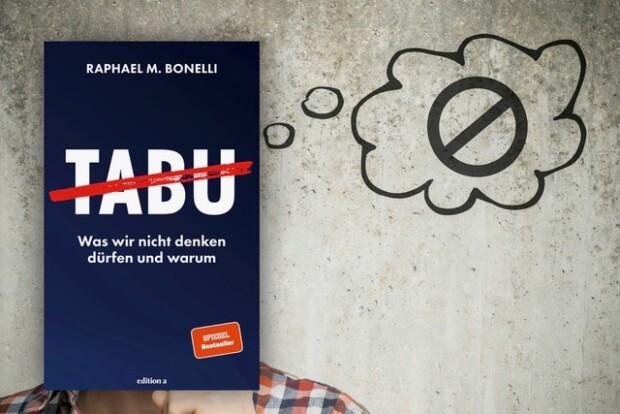







 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























