
Eine träge Gesellschaft liebt Verbote. Denn ein Verbot befreit uns von der Notwendigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, womöglich gar uns unangenehme. Einer Geisteshaltung, die gewöhnlich das, was man will, missversteht als das, was man soll, erscheint nichts kontraintuitiver, als sich selbst etwas aufzuerlegen.
Das betrifft nicht zuletzt den digitalen Medienkonsum. Erwachsene Menschen schaffen es häufig nicht, einige Stunden am Tag offline zu sein, ihr Handy für ein paar Tage daheim zu lassen, oder auf das Doom-Scrolling vor dem Schlafengehen zu verzichten. Obwohl sie selbst der Ansicht sind, dass es ihnen guttäte, das zu tun.
Aber Selbstdisziplin und Wille reichen eben nicht einmal, um das als schädlich und selbstschädigend erkannte Verhalten einzustellen. Wenn nun schon Erwachsene oftmals eher Sklave der digitalen Welt sind, anstatt sich ihrer verantwortungsvoll zu bedienen, wie soll Kindern gesunder Medienkonsum gelingen?
Kein Wunder also, dass immer wieder Stimmen laut werden, die Social-Media- oder Smartphone-Verbote für Minderjährige fordern – zuletzt geäußert vom thüringischen Ministerpräsidenten Mario Voigt. Der setzt sich in einem Gastbeitrag für die FAZ für ein Verbot von Smartphones für Kinder unter vierzehn Jahren ein, soziale Medien sollen Jugendliche erst ab sechzehn Jahren nutzen dürfen. Dies fällt zusammen mit Empfehlungen der Leopoldina. Die hat Maßnahmen vorgeschlagen, darunter einen Verzicht auf die Nutzung von Smartphones in Kitas und Schulen bis zur zehnten Klasse, sowie ein Nutzungsverbot für soziale Medien für Kinder unter dreizehn.
Oberflächlich betrachtet mag das sinnvoll erscheinen. Denn obwohl Anhänger grenzenloser Digitalisierung die Auswirkungen von Smartphone und Internetkonsum weiterhin leugnen, sind die Folgen der Flucht des Menschen in die digitale Pseudoexistenz bereits überall sichtbar – nur weigert man sich, diese Konsequenzen den entsprechenden Ursachen zuzuordnen. Der Realitätsleugnung assistieren die Grenzen der empirischen Wissenschaft: Die Studie, die lückenlos belegt, wie viel glücklicher der mittelalterliche Bauer gegenüber dem postmodernen Smartphone-Dauernutzer ist, wird es nicht geben.
Es braucht Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, keine Empirie, um festzustellen, wie viel schlechter das eigene Gedächtnis funktioniert, wie viel schwieriger es geworden ist, Inhalte auswendig zu lernen und zu behalten, wie viel kürzer die Konzentrationsspanne ist. Noch viel weniger ausgeprägt als die Bereitschaft, diese Probleme anzuerkennen, ist die Bereitschaft, etwas dagegen zu tun. Das Gerät auszuschalten, zum Beispiel.
Ein gesetzliches Verbot aber würde die elterliche und gesellschaftliche Verantwortung für das Kindeswohl durch staatliche Kontrolle ersetzen. Anstatt auf Eigenverantwortung und Menschenverstand zu setzen, soll das Verbot die selbstbestimmte Auseinandersetzung mit dem Thema obsolet machen.
Das ist eine Form von Faulheit und freiwilliger Aufgabe des Geistes und des Willens, die eines freien Individuums unwürdig ist. Eine funktionierende Gesellschaft sollte dem Einzelnen und der Gemeinschaft zuträgliche Verhaltensnormen ohne entsprechende Gesetze entwickeln können: Es gibt kein Gesetz, das zu Begrüßung oder Dank verpflichtet. Dennoch begrüßen und danken wir einander. Ebenso selbstverständlich könnte es sein, reale Kontakte über digitale zu priorisieren, Nachrichten stumm zu schalten, wenn sie ablenken, oder ein physisches Buch statt eines elektronischen zu lesen. Der Eindruck, man könne sich der digitalen Wucht nicht erwehren, ist ein irrtümlicher. Eine Gesellschaft, die ihre Kultur über Gesetze steuern muss, besitzt keine echte Kultur mehr.
Social-Media-Verbote und Smartphone-Verbote für Kinder sind sinnvoll – aber sie müssen den individuellen Bedürfnissen des jeweiligen Kindes entsprechen, und sie sollten mit der Vorbildfunktion der Erwachsenen verknüpft sein. Wenn Eltern und Erwachsene keinen verantwortungsvollen Umgang mit der digitalen Welt vorzuleben gewillt sind, ist ein Verbot für Kinder und Jugendliche heuchlerisch. Zudem nimmt es Kindern pauschal die Möglichkeit, an den positiven Aspekten der Online-Welt teilzuhaben; etwa am Zugang zu Wissen und Information, oder am Austausch mit Menschen und Gleichgesinnten aus der ganzen Welt.
„Kindheit statt Klicks“ ließ Voigt auf X verlauten. Das klingt sympathisch und griffig, und das ist auch vollkommen richtig. Aber das gilt auch für die Erwachsenen, die die Kinder anleiten: Auch sie müssen an der Kindheit der Kinder teilhaben, anstatt durch Abwesenheit zu glänzen, und dem Staat zu überlassen, zu entscheiden, was für das eigene Kind richtig ist. Die Gängelung der Kinder geht einher mit Infantilisierung und Entmündigung der Erwachsenen.
Dies führt zum politisch brisanten Aspekt dieser Forderung: Die Sicherheit, die Entwicklung und das Wohlergehen der Kinder sind lediglich vorgeschoben, um unter dem Deckmantel des Kinderschutzes digitale Kontrolle zu implementieren.
Denn um das Alter eines Nutzers festzustellen, muss dieser seine Daten zugänglich machen. Es lässt aufhorchen, wenn die Leopoldina am ehesten auf EU-Ebene Möglichkeiten zur Regulierung sieht. Noch mehr Kontrolle. Noch weniger Freiheit. Davon abgesehen werden junge Menschen, die ab sechzehn ja bereits wählen dürfen, von politischer und anderweitiger Meinungsbildung, die zu einem maßgeblichen Teil online erfolgt, ausgegrenzt.
Das Kindeswohl als Einfallstor zu nutzen für Politik und Regierungen, die den digitalen Raum kontrollieren wollen, ist ein durchschaubares aber nichtsdestotrotz demokratiegefährdendes und antifreiheitliches Manöver.



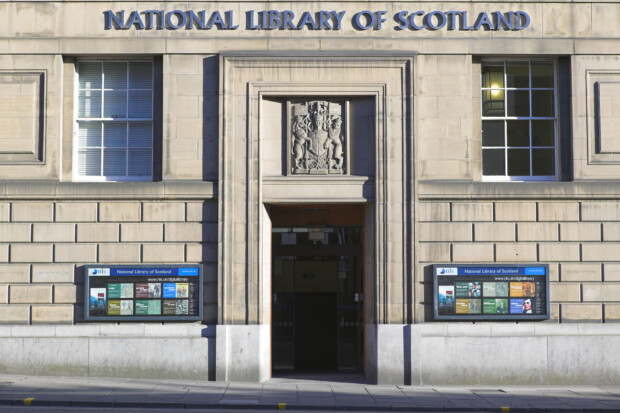



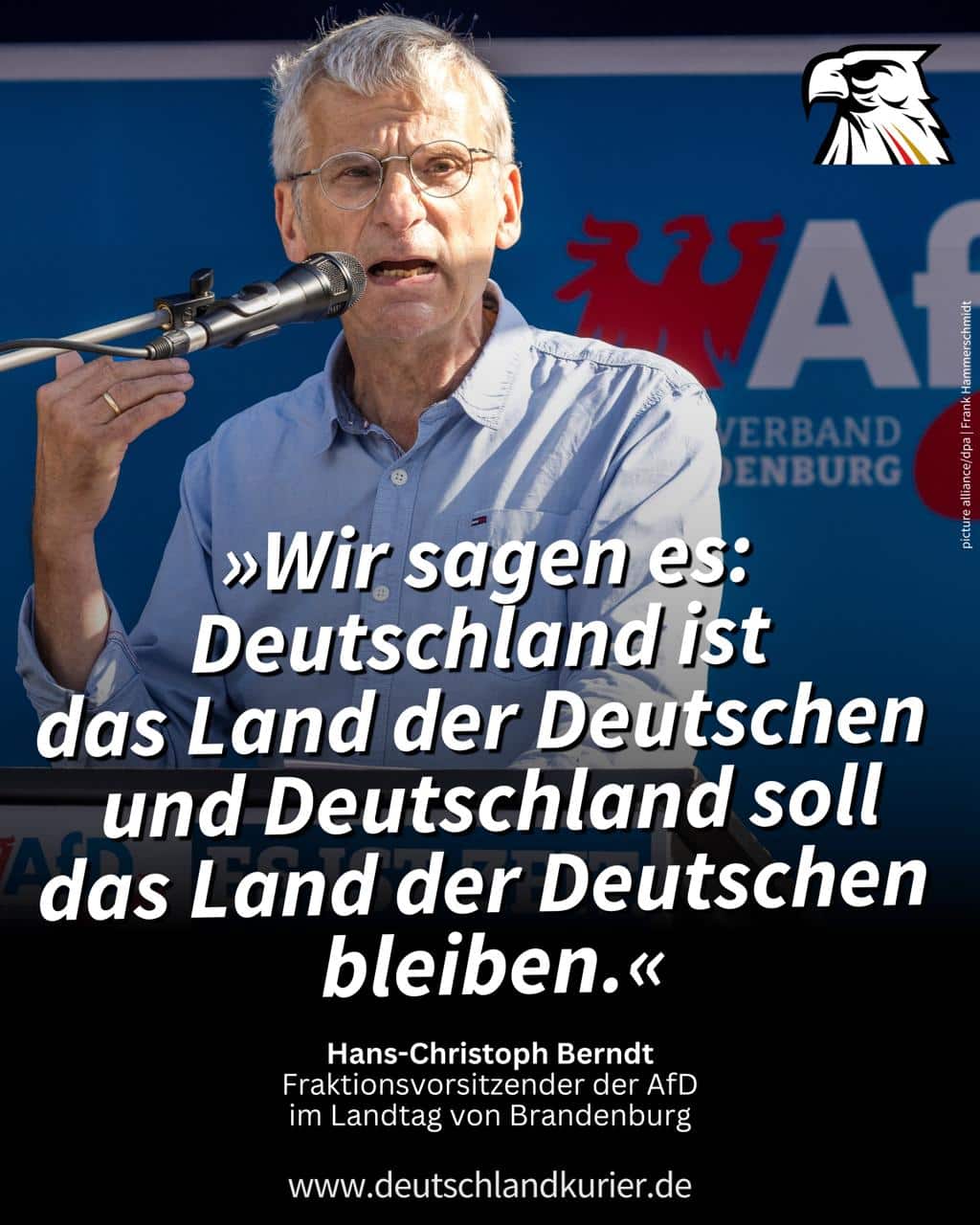
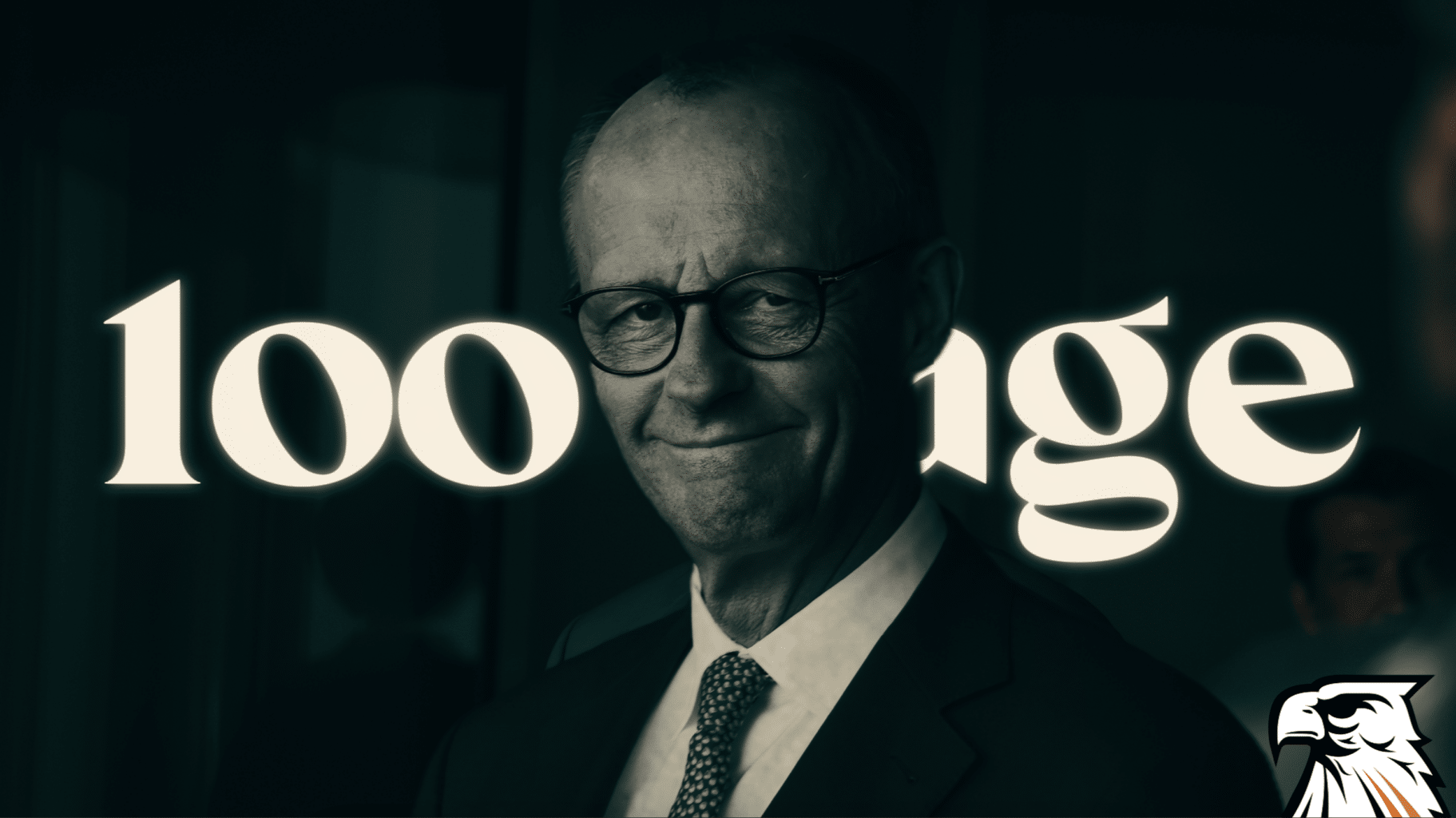
 PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM
PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM






























