
Die Forderungen, Schwangerschaftsabbrüche prinzipiell, und über das bisher geltende Zeitfenster von 12 Wochen hinaus in Deutschland zu legalisieren, werden seit einigen Jahren immer lauter: Organisationen wie Pro Familia, die damit ganz auf Linie ihrer Mutterorganisation International Planned Parenthood liegt, stimmen in diesen Chor ebenso mit ein wie Doctors for Choice oder das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.
Der Fokus liegt bei allen Forderungen stets ausschließlich auf der ungeplant Schwangeren, deren Problem mit einer Abtreibung ihres ungeborenen Kindes gelöst werden soll – und für diese Problemlösung möchte man gern mehr Zeit haben. Ausgeblendet wird jedoch, dass auch für die Schwangere eine spätere Abtreibung mit einer deutlichen Steigerung der gesundheitlichen Risiken einhergeht, die sowohl physischer als auch psychischer Natur sein können.
Und selten bis gar nicht wird aber darüber gesprochen, was bei einem Schwangerschaftsabbruch im zweiten oder gar letzten Schwangerschaftsdrittel tatsächlich passiert.
Von einer solchen Spätabtreibung spricht man in der Regel, wenn die Abtreibung nach Ablauf der gesetzlich zugelassenen Frist erfolgt. Oft wird der Begriff auch erst ab der 22. oder 24. Schwangerschaftswoche verwendet, da ab diesem Zeitpunkt der Fötus eine Überlebenschance außerhalb des Mutterleibes hätte. Europas jüngstes Frühchen kam vor 12 Jahren in der 22. Schwangerschaftswoche in Fulda zur Welt.
Diesem Umstand – immer frühere Überlebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibes – ist es geschuldet, dass Spätabtreibungen nicht zu den besonders beliebten Eingriffen unter Gynäkologen gehören. Sie sind nicht nur mit einer höheren Komplikationsrate verbunden als Abtreibungen in einem früheren Schwangerschaftsstadium, sondern auch mit rechtlichen Risiken für den betroffenen Arzt.
Solche Abtreibungen können auf verschiedene Weisen durchgeführt werden. Eine ist die vorzeitige Geburt. Zur Verwendung kommt Misoprostol, ein Medikament, das die Geburt einleitet und zu Kontraktionen der Gebärmutter sowie zur Erweichung des Muttermundes führt. Das Medikament ist umstritten – es kann zu einer Überstimulation der Gebärmutter und dem gefürchteten sogenannten „Wehensturm“ führen – und ist auch nicht für die Geburtseinleitung zugelassen, sondern als Medikament zur Behandlung von Magengeschwüren.
Das ungeborene Kind stirbt entweder schon während der Geburt oder unmittelbar danach. Allerdings hat es Fälle von Kindern gegeben, die auch nach Stunden nicht gestorben sind, was die Ärzte vor ein Dilemma stellt: entweder sie töten aktiv das Kind und erfüllen somit den Behandlungsvertrag mit seinen Eltern, oder sie leisten Überlebenshilfe und können auf Grund der „Kind als Schaden“-Rechtsprechung zu Schadensersatzzahlungen an die Eltern verurteilt werden.
Für Aufsehen sorgte Tim, bei dem die Ärzte ein Down-Syndrom diagnostizierten und die Eltern daher eine Abtreibung beauftragten. Tim überlebte jedoch, war auch nach Stunden noch nicht tot und wurde schließlich intensivmedizinisch betreut. Ein Ehepaar adoptierte ihn, er starb im Alter von 22 Jahren.
Um also sicher zu gehen, dass das ungeborene Kind nicht überlebt, injiziert der Arzt dem Fötus eine Kalium-Chlorid-Lösung oder Lidocain unter Ultraschallsteuerung in die Nabelschnurvene oder sein Herz, um dessen Stillstand zu erreichen. Das Mittel kommt auch bei Hinrichtungen in den USA zum Einsatz, allerdings wird hier den Betroffenen zuvor ein Narkosemittel verabreicht. Alternativ und technisch wesentlich einfacher können auch 1-2 mg Digoxin in die Fruchtblase injiziert werden. Digoxin führt zu einer Steigerung der Caliumkonzentration in den Herzzellen, es kommt zu Herzryhtmusstörungen. Der Tod des Kindes tritt hierbei jedoch erst nach Stunden ein. Die Verabreichung von Schmerzmitteln oder Beruhigungsmitteln ist bei den ungeborenen Kindern nicht vorgesehen.
Ebenfalls zum Einsatz kommt eine Kombination aus zwei chemischen Präparaten. Hierbei erhält die Mutter Mifepriston und Misoprostol. Mifepriston wirkt, indem es das schwangerschaftserhaltende Hormon Progesteron an seinen Rezeptoren blockiert. Progesteron verhindert die Kontraktion der Gebärmutter und sorgt dafür, dass sich der Fruchtsack mit dem Kind nicht von der Plazenta ablöst. Durch die Blockade wird die Wirkung von Progesteron aufgehoben, die Versorgung des Kindes über die Plazenta kommt zum Erliegen, es verhungert.
Dieser Prozess zieht sich über mehrere Tage hin, wobei mehrmals Mifepriston verabreicht wird. Es macht zusätzlich die Gebärmutter empfänglicher für ein zweites Medikament, meist ein Prostaglandin (z.B. Misoprostol). Dieses löst Wehen aus, sodass die Geburt eines dann toten Kindes erfolgt. Auch hier ist keine Anästhesie des Kindes vorgesehen.
Eine weitere Methode ist die Dilatation und Kürettage (D&C). Hierbei kommt ebenfalls Misoprostol zum Einsatz sowie Laminaria-Stäbchen (spezielle, in die Gebärmutter eingeführte Stäbchen, die sich mit Flüssigkeit vollsaugen und so den Gebärmutterhals etwas aufdehnen). Sie bereiten auf die Dilatation vor, bei der der Gebärmutterhals mit speziellen Instrumenten schrittweise aufgedehnt wird. Sobald die notwendige Dehnung erreicht ist, wird eine Saugkanüle eingeführt, die das ungeborene Kind sowie die Gebärmutterschleimhaut absaugt. Nach der 16. Schwangerschaftswoche erfolgt die Entfernung des ungeborenen Kindes „oft in Teilen“ (Ulrich Gembruch, Schwangerschaftsabbruch im ersten, zweiten und dritten Trimester, in: Die Geburtshilfe.)
Das zu diesem Zeitpunkt voll entwickelte Kind würde in die Handfläche der Mutter passen, ist aber für die Saugkanüle zu groß. Daher kommen nun Zangen (Forceps) und Küretten (Schaber) zum Einsatz. Die Operation erfolgt unter Ultraschallkontrolle, um zielgerichtet vorgehen zu können und mit den scharfen Instrumenten keine Verletzung der Gebärmutterwand zu verursachen. Auch bei dieser Form der Abtreibung ist keine Anästhesie des ungeborenen Kindes vorgesehen. Die D&C hat eine Rate an schweren Komplikationen von 1-2 %, diese umfassen Uterusperforationen, uterine Blutungen, Risse des Gebärmutterhalses und postoperative Infektionen. Es ist unbedingt erforderlich zu überprüfen, dass das Kind vollständig aus der Gebärmutter entfernt wurde, da es sonst zu Komplikationen (starke Blutungen, Infektionen) kommen kann.
Eine andere Art der Spätabtreibung ist die sogenannte Teilgeburtsabtreibung. Sie ähnelt dem D&C Verfahren. Zunächst wird der Gebärmutterhals geweitet, dann das Kind in Beckenendlage (Füße zuerst) in den Geburtskanal gezogen. Der Körper wird so weit wie möglich geboren, bis auf den Kopf, der noch im Geburtskanal verbleibt. Während der Kopf noch im Geburtskanal ist, wird mit einem chirurgischen Instrument ein Zugang zum Schädel geschaffen, der Inhalt des Schädels (Gehirn) abgesaugt, um den Kopf zu verkleinern und die Entbindung zu erleichtern. Dadurch stirbt der Fötus und kann vollständig entfernt werden. Diese Form der Abtreibung wurde 2003 in den USA von der Bush-Administration verboten und ist nur noch in Ausnahmefällen (Gefahr für das Leben der Mutter) erlaubt. In den deutschen Leitlinien zum Schwangerschaftsabbruch spielt sie keine Rolle.
Von Abtreibungen sind immer mindestens zwei Personen betroffen – eine ist das ungeborene Kind, das andere die Schwangere in Not. Wahr ist, dass diese Schwangere sich oft existentiell bedroht fühlt, unter Druck gesetzt und verängstigt. Wahr ist aber auch, dass eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Dramatik ungewollter Schwangerschaften nur möglich ist, wenn alle Details der Problemlösung „Abtreibung“ bekannt sind. Auch jene, die das ungeborene Kind betreffen.
Cornelia Kaminski ist Bundesvorsitzende der „Aktion Lebensrecht für Alle“, der größten Pro Life Organisation Deutschlands. Sie vertritt die ALfA im Vorstand des Bundesverbands Lebensrecht und ist Landesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben in Hessen.





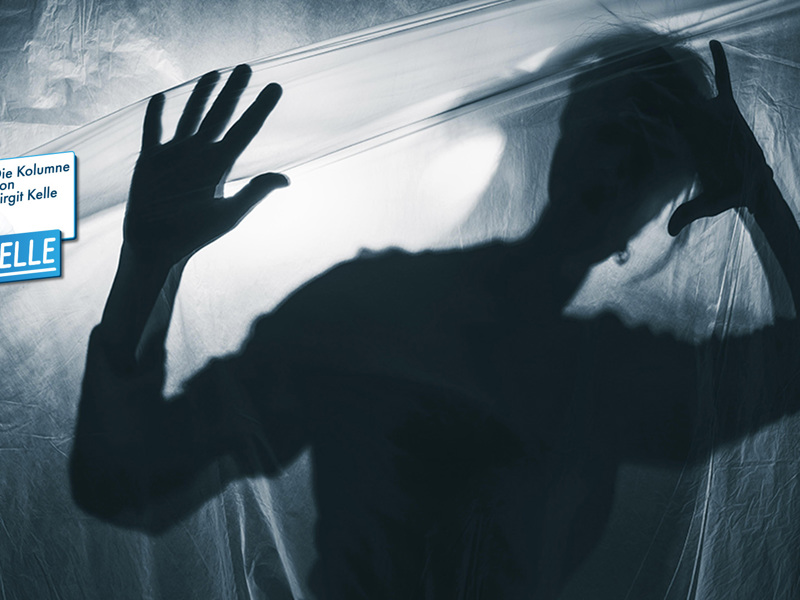


 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























