
Persönliche Beliebtheit im Keller (32 Prozent), die Union (27,5 Prozent) nur knapp vor der AfD (24 Prozent) und jede Menge Streitthemen in der eigenen Koalition: Wer wissen will, wie und warum Kanzler Friedrich Merz (CDU) den Rückhalt in den eigenen Reihen verliert, bekommt in diesen Tagen ein Paradebeispiel vorgeführt.
Sonntagabend, 20:40 Uhr: „Ich begrüße die Einigung zwischen Ursula von der Leyen und Donald Trump in den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kanzleramts. „Es ist gut, dass Europa und die USA sich geeinigt haben und so eine unnötige Eskalation in den transatlantischen Handelsbeziehungen vermeiden. (...) Wir haben so unsere Kerninteressen wahren können, auch wenn ich mir durchaus weitere Erleichterungen im transatlantischen Handel gewünscht hätte. Von stabilen und planbaren Handelsbeziehungen mit Marktzugang für beide Seiten profitieren alle – diesseits wie jenseits des Atlantiks, Unternehmen wie Verbraucher.“
In seinem Pressestatement am Montag vollzog Merz eine Kehrtwende in der Beurteilung des Zoll-Deals mit den USA.
Keine 24 Stunden später: „Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass die Zölle, die jetzt bleiben – das sind insbesondere die 15 Prozent gegenüber 0 Prozent für die Importe in die Europäische Union –, eine erhebliche Belastung der exportorientierten Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Das ist völlig klar. Sie werden sich daran erinnern, dass ich in den letzten Tagen immer wieder darauf hingewiesen habe, dass es ein asymmetrisches Abkommen geben wird, wenn es denn überhaupt eins gibt. Ich bin mit diesem Ergebnis nicht zufrieden im Sinne von: Das ist jetzt gut so, sondern ich sage nur, dass offensichtlich angesichts der Ausgangslage, die wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika hatten, nicht mehr zu erreichen war. Das heißt jetzt im Klartext, dass die deutsche Wirtschaft durch diese Zölle erheblichen Schaden nehmen wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht auf Deutschland und Europa allein begrenzt bleiben wird.“
Dass Politiker mit etwas Abstand zu den Dingen unterschiedliche Akzente und Tonlagen setzen, ist normal. Nicht normal ist, dass sich ein Kanzler der Bundesrepublik Deutschland im Kanzleramt hinstellt, erst eine Luftbrücke für Gaza bekanntgibt und dann in musterschülerhafter Gleichmütigkeit erklärt, die deutsche Wirtschaft werde durch ein neues Abkommen „erheblichen Schaden nehmen“. Er habe ja schon vorher gesagt, dass es ein „asymmetrisches Abkommen geben wird“.
Ein Bundeskanzler wird nicht für kluge Kommentare zum politischen Geschehen bezahlt (und gewählt), sondern dafür, sich mit aller „Kraft dem Wohle des deutschen Volkes (zu) widmen, seinen (zu) Nutzen mehren, Schaden von ihm (zu) wenden“. Ganz gleich, ob im Bundespresseamt am Sonntag niemand mehr Lust hatte, länger über den Text nachzudenken oder ob Merz am Montag einfach nur flapsig formuliert hat: Ein Abkommen, das der deutschen Wirtschaft „erheblichen Schaden“ zufügt, kann ein Regierungschef nicht einfach so zur Kenntnis nehmen. Zumal dann nicht, wenn die deutsche Wirtschaft ohnehin schon stagniert.
Für Merz geht es hier auch nicht um kleinliche Wortklauberei, sondern um das Themenfeld Wirtschaft, für das er und die Union noch hohe Kompetenzzuweisungen genießen. Noch. Das gebrochene Wahlversprechen für die Einhaltung der Schuldenbremse hat nicht nur außerhalb der Union Vertrauen gekostet, sondern auch in den eigenen Reihen. Der Verzicht auf die eigentlich versprochene Senkung der Stromsteuer für alle und die Vorahnung, dass die längst überfälligen Sozialreformen mit dem Koalitionspartner SPD kaum zu machen sein werden, all das kommt erschwerend hinzu und kostet Merz spürbaren Rückhalt in den eigenen Reihen.
Die Wortwahl von Merz’ Parteifreunden wird in diesen Tagen deutlich härter. Christoph Ahlhaus (CDU), früher Erster Bürgermeister von Hamburg und heute Chef des deutschen und europäischen Mittelstandsverbands, rechnete jetzt in Bild ab: „Nach drei Jahren Krise bekommen die europäischen Unternehmen jetzt noch einmal 15 Prozent auf alles. Was uns die EU-Kommissionspräsidentin als Zoll-Durchbruch verkaufen will, ist in Wahrheit eine Kapitulation.“ Merz habe in Washington gezeigt, wie man Amerika auf Augenhöhe gegenübertreten könne, sagte er weiter und fordert: „Wenn die Kommissionspräsidentin hierzu nicht in der Lage ist, muss Merz die Konsequenzen ziehen. Die Rücksichtnahme gegenüber von der Leyen auf Kosten der deutschen Wirtschaft dauert schon zu lange. Damit muss jetzt Schluss sein.“ Als CDU-Chef hatte Friedrich Merz die erneute Amtszeit von Ursula von der Leyen offen unterstützt.
Christoph Ahlhaus bezeichnet den Deal zwischen der EU und den USA als „Kapitulation“.
Dass die Wahl der drei Verfassungsrichter in der Unionsfraktion auf massiven Widerstand stieß, ist nur der sichtbare Teil eines gar nicht mehr schleichenden Verlusts an Rückhalt für den Regierungschef. Zu Beginn waren es nur einige öffentlich weniger bekannte Personalien: Merz’ Büroleiterin Andrea Verpoorten gab schon im Frühjahr 2022 auf. Ex-Innenstaatssekretär Markus Kerber räumte gut ein Jahr später sein Büro als Merz-Berater im Adenauer-Haus. Öffentlich spricht er nicht über die Gründe, intern aber ist von Beratungsresistenz des heutigen Kanzlers die Rede.
Inzwischen sind auch andere langjährige Unterstützer ausgerechnet aus Baden-Württemberg auf Distanz, die lange Zeit als „Merz-Ultras“ galten. So ist es kein Zufall, dass gerade im mächtigen Parlamentskreis Mittelstand (PKM) von Christian von Stetten (Schwäbisch Hall / Hohenlohe) die entscheidenden Stimmen für die Wahl der SPD-nahen Juristin Frauke Brosius-Gersdorf fehlten. Gerade beim Wirtschaftsflügel der Union sitzt das Misstrauen tief, weil die abgehobene Vorliebe des Kanzlers für internationale Auftritte gepaart mit einer gewissen Selbstgefälligkeit Zweifel wecken, ob seine Sorge tatsächlich dem Land oder lediglich dem eigenen Amt gilt.
Fakt ist aber, dass die Unionsfraktion inzwischen keineswegs mehr gewillt ist, im Sinne der eigenen Machtsicherung gefügig der Führung zu folgen. Jüngster Abgang: Die „Junge Gruppe“ um den Hessen Pascal Reddig, Junge-Union-Chef Johannes Winkel oder Kohl-Enkel Johannes Volkmann (alle CDU) protestierten öffentlich gegen die Megaverschuldung und dringt intern beharrlich auf tiefgreifende Sozialreformen. Es ist ihre Generation, die die Folgen der Merz-Politik wird ausbaden müssen. Für Loyalität zum Kanzler können sie sich draußen im Land bei den Wählern, aber auch später im Zuge einer möglichen Politiker-Karriere nichts kaufen, wenn die Zinslasten die Spielräume des Staates verengen.
Merz hat erkennbar kein Gespür für die Stimmungslage seiner „Fußtruppen“, auf die er aber gerade mit einem schwierigen Koalitionspartner wie der SPD angewiesen ist. Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) wiederum hat (noch?) nicht den Status, Gefolgschaft durch Druck organisieren zu können, solange ihn die Nachwehen der Masken-Beschaffung zu Corona-Zeiten in Atem halten. Überhaupt funktionieren die rund sechzig Neuzugänge in der Unionsfraktion auch nicht mehr so geschmeidig, wie das ehedem unter Kanzlerin a.D. Angela Merkel der Fall war. Viele der jungen Abgeordneten sind nicht bereit, sich für das Mandat über Gebühr zu verbiegen und nehmen eher die Rückkehr ins Zivilleben in Kauf, denn als „Parteisoldat“ zu überwintern.
„Für Luftbrücken in Gaza oder G7-Gipfel kann ich mir bei meinen Wählern nichts kaufen“, sagt einer, der die Stimmung an der Unionsbasis als außerordentlich „mies und bedrückend“ beschreibt. „Wir sind für die kleinen Leute da“, zitiert er einen Spruch von Ex-CSU-Chef Horst Seehofer. „Die Großen können sich ganz gut um sich selbst kümmern.“ Merz versteht die einfachen Leute nicht, soll das wohl heißen.
In der Öffentlichkeit halten sich die Jungen und die anderen Dissidenten noch zurück. Nur blind auf ihre Gefolgschaft verlassen kann sich der Kanzler nicht.
Lesen Sie auch von Ralf Schuler:








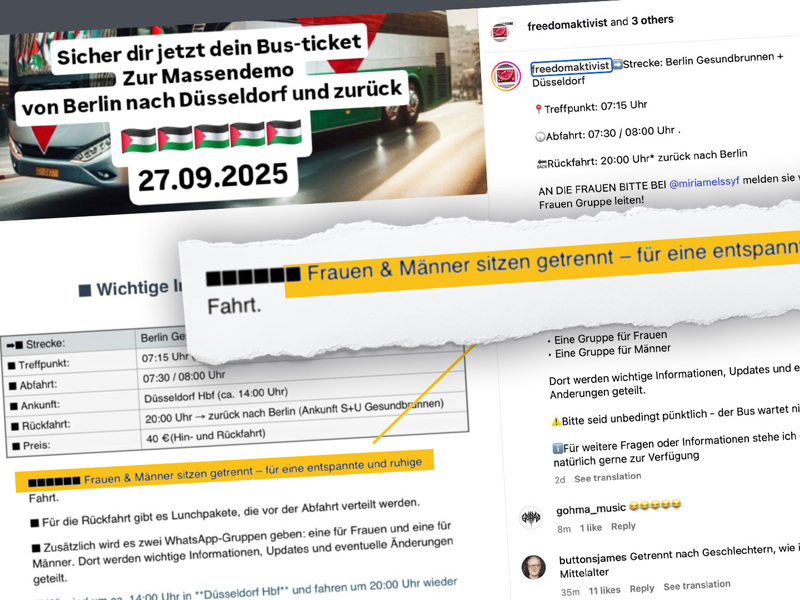
 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























