
Die Justiz in Deutschland ist hoffnungslos überlastet. Mehr als 933.000 Fälle sind laut dem Deutschen Richterbund aktuell offen. Vor diesem Hintergrund mutet der Furor, mit dem Politiker gegen läppische Beleidigungen klagen und Meinungen kriminalisieren, völlig unverhältnismäßig an. Versuchen sie die Gerichtsbarkeit vor ihren Karren zu spannen?
Was sind die größten Probleme, die es mit den Mitteln des Gerichtswesens in den Griff zu bekommen gilt? Wenn es nach den Berliner Grünen geht: Hass und Hetze im Netz. Sie fordern „eine Berliner Meldestelle für digitale Gewalt“, die „Meldungen entgegennimmt und die Kooperation der Strafverfolgungsbehörden koordiniert“ (NIUS berichtete). Zudem benötige es „eine Online-Streife beim BKA, welche kurzfristig gebildet und durch Beamt*innen aus Bund und Ländern besetzt wird“. Die Grünen wünschen sich, dass die Polizisten „im Netz nach strafbaren Inhalten suchen und die Löschung veranlassen“ (NIUS berichtete).Die Polizei soll also verstärkt nach unliebsamen Meinungsäußerungen fahnden, die Staatsanwaltschaften selbst gegen Täter von Bagatelldelikten Anklage erheben. Wenn es um die gebetsmühlenartig beschworene, angeblich drohende Gefahr von Rechts für die Demokratie geht, muss die Strafverfolgung von Mord und Totschlag und anderen Gewaltdelikten oder Sexualverbrechen zurückstehen.
Zuletzt gab es im Juni einen bundesweiten „Aktionstag gegen Hasskriminalität im Internet“, bei dem 170 Razzien durchgeführt wurden, mit Fokus auf rechtsradikale Äußerungen. Die Urheber müssten „jederzeit mit einer konsequenten Strafverfolgung rechnen“. Politisch motivierte Kriminalität oder solche, die man dafür hält – darauf liegt der Fokus. Wobei das Augenmerk vor allem dem rechten Spektrum gilt, dem zwei Drittel der strafbaren Hasspostings zugeordnet wurden.
Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für 2024 hat die Gewaltkriminalität mit insgesamt 217.300 Fällen den höchsten Stand seit 2010 erreicht, aber Straftaten wie Beleidigung, Bedrohung oder Volksverhetzung genießen in der Politik größere Aufmerksamkeit. Der Volksverhetzungs-Paragraf 130 StGB, der einst den Straftatbestand klar definierte, wurde zu einem Gummiparagrafen gemacht, der inzwischen auch angewendet wird, wenn der „öffentliche Friede“ überhaupt nicht gefährdet wird.
Und § 188 StGB stellt die Beleidigung von Personen des politischen Lebens unter Strafe und sieht dafür eine höhere Strafe als bei der Beleidigung einfacher Bürger vor. Insbesondere empfindliche Politiker von Robert Habeck und Annalena Baerbock (Grüne) über Sawsan Chebli (SPD) bis zur Rekordhalterin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) erstatteten wegen teilweise lächerlicher Schmähungen viele hundert Anzeigen. Strack-Zimmermann allein beschäftigt bis zu vier Staatsanwälte mit der Flut ihrer Anzeigen.
Die dauerbeleidigte Marie-Agnes Strack-Zimmermann hält die Staatsanwaltschaft auf Trab.
Agenturen wie „So Done“ oder „HateAid“ erfassen im Rahmen ihrer Tätigkeit Beleidigungen und vermitteln sie an Anwälte. Zahllose Strafverfahren wegen politischer Äußerungen sind die Folge. Die NZZ berichtete, für Online-Straftaten wie Hate-Speech, Bedrohungen oder Beleidigungen per E-Mail biete etwa die bayerische Justiz Kommunalpolitikern und Abgeordneten (Mitglieder des Bayerischen Landtags, bayerische Mitglieder des Bundestags und des Europäischen Parlaments) einen an die besonderen Bedürfnisse der Mandatsträger angepassten Zugang zu einem vereinfachten Online-Meldeverfahren an. Ein Hate-Speech-Beauftragter sorge für eine besonders engagierte Bearbeitung der Fälle im Freistaat.
Zu „Hassverbrechen“ im Internet gibt es keine spezifische Gesamtzahl für 2024 in den verfügbaren Daten, aber es wird erwähnt, dass etwa 70 Prozent der Straftaten gegen Politiker in Sachsen-Anhalt im Jahr 2023 über soziale Medien begangen wurden, was auf einen hohen Anteil von Online-Beleidigungen hinweist.
Bei fast 150.000 offenen Haftbefehlen in Deutschland – darunter 1.473 gesuchte Straftäter wegen Mord und Totschlag und 1.856 Personen wegen Vergewaltigungen – darf die verschärfte Verfolgung von Bürgern, die Kot-Emojis oder plumpe Beleidigungen auf einer Social-Media-Plattform posten, mit Fug bezweifelt werden.
Bei den Staatsanwaltschaften in den Bundesländern stapeln sich die Aktenberge: Mehr als 933.000 Fälle sind laut dem Deutschen Richterbund aktuell offen. Kein Wunder, wenn ständig neue Straftatbestände geschaffen werden. Der erwähnte Paragraf 130 StGB wird ständig erweitert, entsprechend wächst die Zahl von Anzeigen wegen „Hass und Hetze“ im Netz.
Fast eine Million Fälle sind unerledigt – die Justiz wird ihrer nicht mehr Herr.
Und das, wo die Justiz ohnehin vor einem Haufen unerledigter Fälle steht: 2000 Richter und Staatsanwälte fehlten derzeit bundesweit, heißt es – bei zu wenigen Bewerbern. Dabei kämen ständig neue Gesetze hinzu, die Verfahren würden komplizierter. Die Gerichte kämen kaum noch hinterher. Dauerte ein Strafverfahren am Landgericht im Jahr 2013 in erster Instanz ab Eingang bei der Staatsanwaltschaft durchschnittlich 17,2 Monate, waren es 2023 schon 21,5 Monate – ein Anstieg um 25 Prozent. Auch besonders lange Verfahren haben zugenommen: Fast jeder Zehnte muss mehr als vier Jahre auf die Erledigung seines Verfahrens warten.Das Problem wird sich noch verschärfen, weil eine große Pensionierungswelle auf die Justiz zurollt: In den kommenden zehn Jahren treten 40 Prozent aller derzeit aktiven Staatsanwälte und Richter bundesweit in den Ruhestand. In den neuen Bundesländern sind nach einer aktuellen Studie des Richterbundes zur Zukunftsfähigkeit der Justiz rund 60 Prozent aller Juristen in Gerichten und Staatsanwaltschaften zu ersetzen.
Weil einige Untersuchungshaft-Verfahren länger dauern als gesetzlich erlaubt, werden immer wieder Beschuldigte aus der Untersuchungshaft entlassen. 62 Inhaftierte mussten im vergangenen Jahr vorerst freigelassen werden. In den vergangenen fünf Jahren waren es 259 Personen. Laut eines Berichts in der Welt laufen die Verfahren in solchen Fällen weiter: „Die mutmaßlichen Straftaten, um die es ging: Mord, versuchter Mord, Totschlag, Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung, Raub oder Drogenhandel im großen Stil.“Hingegen werden große Anstrengungen unternommen, um „digitale Gewalt“ zum Problem unserer Zeit hochzujazzen. Seit Nancy Faeser als Bundesinnenministerin dekretierte, „diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen“, wird verstärkt gegen Leute vorgegangen, die zum Beispiel ein harmloses Schwachkopf-Meme verbreiten. Der Gedanke dahinter: Abschreckung. Jeder soll sich dreimal überlegen, wie er sich im Internet politisch äußert, und im Zweifel lieber den Mund halten.
Gegen den User, der das Schwachkopf-Meme postete, ging die Justiz gnadenlos vor.
Getreu dem Diktum Mao Tse Tungs „Bestrafe einen, erziehe hundert“ will die Politik die Unzufriedenheit der Bürger eindämmen, indem sie hart gegen renitente Untertanen vorgeht und vielleicht durchaus plumpe, aber legitime (weil unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegende) Meinungsäußerungen kriminalisiert.
Derbe Beleidigungen gegen einzelne Protagonisten der etablierten Parteien werden dabei in die Nähe der Verfassungsfeindlichkeit gerückt, der Kritiker so zum potenziellen Staatsfeind. „Der Staatsschutz ermittelt“ – das hört und liest man immer öfter, auch wenn der Staat nicht wirklich vor einer ernsten Gefahr geschützt werden muss. Früher befasste sich die Einheit der Polizei mit der Verhütung und Verfolgung von politisch motivierter Kriminalität, etwa Straftaten, die im Zusammenhang mit Extremismus, Terrorismus oder Spionage standen. Neuerdings geht sie vor allem gegen Äußerungsdelikte vor.
Und selbst da, wo ein tatsächlich geplanter Umsturz medienwirksam mit enormem personellem Aufwand und unter erheblichem medialem Tamtam in letzter Sekunde vereitelt wird, sind Zweifel angebracht. Die meisten Angeklagten im „Reichsbürger“-Prozess, insbesondere die mutmaßliche Putschisten-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß, sitzen seit der Großrazzia am 7. Dezember 2022 in Untersuchungshaft. Der Prozess dauert seit 13 Monaten an. Wer weiß, ob am Ende überhaupt was herauskommt.
Die Prozesse gegen die mutmaßlichen Umstürzler um Heinrich XIII. Prinz Reuß ziehen sich über Jahre.
Michael Ballweg, der Gründer der „Querdenken“-Bewegung, verbrachte geschlagene neun Monate in Untersuchungshaft – wegen des Verdachts auf versuchten Betrug, Geldwäsche sowie Steuerhinterziehung. Dabei hatte das Landgericht Stuttgart vorgeschlagen, das Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen, da der Nachweis eines vorsätzlichen Betrugs oder einer erheblichen Steuerhinterziehung unwahrscheinlich sei. Die Staatsanwaltschaft wollte nicht lockerlassen. Ein endgültiges Urteil liegt immer noch nicht vor, die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung erscheint jedoch gering, da das Gericht Schwierigkeiten sieht, Ballweg Vorsatz nachzuweisen.
Der Verdacht drängt sich auf, dass hier versucht wird, einen Bürger „dranzukriegen“, der es gewagt hat, die staatlich verordneten Maßnahmen in der Corona-Zeit zu kritisieren und Demonstrationen zu organisieren, statt seinen Protest, wie von Nancy Faeser vorgeschlagen, ohne Versammlungen in der Öffentlichkeit auszuleben.
Beide Fälle beschäftigen die Justiz schon jetzt über Gebühr. Es sind die bekannteren Fälle, die vielen „kleinen“ bleiben meist unbekannt, wie etwa die hysterische Verfolgung von „Ausländer raus“-Gesängen zur Melodie von Gigi d’Agostinos bekanntem Hit „L’amour toujours“, die nicht nur die Sylt-Schnösel zu Tätern stempelte, die sie am Ende nicht waren – was man auch schon vorher wissen konnte, wenn man nicht vom Nazi-Fimmel besessen war.
Die gnadenlose Verfolgung solcher Bagatellfälle steht in keinem Verhältnis zu ihrer Bedeutung. Dem Strafrechtler Udo Vetter zufolge geht sie Polizeibeamten „unglaublich auf die Nerven: Sie sagen: ‚Das kann doch nicht euer Ernst sein! Bei uns nimmt der Bestand der Kriminalität überhand und es geht alles den Bach runter und wir müssen so viele, unzählige Arbeitsstunden mit solchen Kamellen verbringen‘.“
Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Sven Rebehn, warnte bereits vor einem politischen Missbrauch der Strafverfolgung. Die „gesetzlichen Einfallstore“ für einen politischen Missbrauch der Strafverfolgung müssten „dringend geschlossen“ werden: „Das aus dem vorletzten Jahrhundert stammende Weisungsrecht der Justizminister für Ermittlungen der Staatsanwaltschaften ist Gift für das Vertrauen der Menschen in eine objektive Strafjustiz.“
Die Justiz muss aufpassen, dass sie sich nicht vor den Karren der Politik spannen lässt. Die Gewaltenteilung ist ein hohes Gut. Wenn die Menschen erleben, dass Straftäter wegen der überlasteten Justiz frei herumlaufen, während sie selbst für ihre Wut darüber der „Hassrede“ bezichtigt werden, wird der Unmut weiter wachsen. Was die Politik dann dazu antreibt, noch mehr Gefahren für die Demokratie zu wittern. Ein Teufelskreis.
Lesen Sie dazu auch:



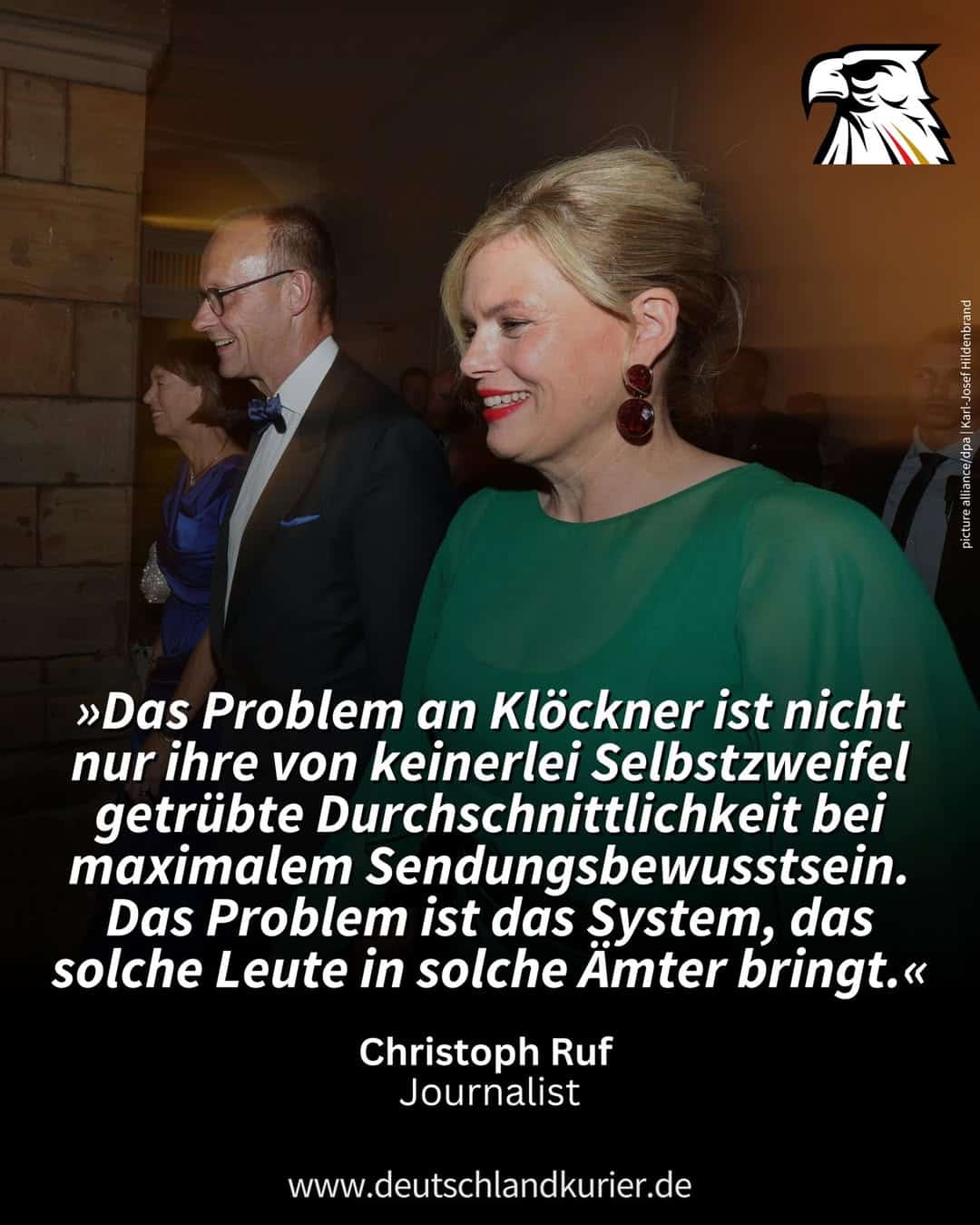






 PUTINS KRIEG: Russland will Angriffe auf Ukraine verstärken! Selenskyj will Sanktionen | WELT STREAM
PUTINS KRIEG: Russland will Angriffe auf Ukraine verstärken! Selenskyj will Sanktionen | WELT STREAM






























